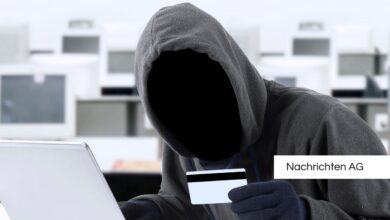Die Wärmewende in Deutschland nimmt Gestalt an: Bis spätestens 2028 müssen alle Städte und Gemeinden eine eigene Wärmeplanung vorlegen. Aktuellen Berichten zufolge haben bereits 34 Prozent der Kommunen mit der Erstellung ihrer Wärmepläne begonnen. Diese Informationen stammen vom Kompetenzzentrum Wärmewende (KWW) in Halle (Saale), das auch feststellt, dass alle großen Kommunen bereits aktiv an der Planung arbeiten.
Baden-Württemberg zeigt sich besonders fortschrittlich, mit 13 Prozent der Kommunen, die ihre Wärmepläne bereits abgeschlossen haben. Von 160 bundesweit abgeschlossenen Wärmeplänen stammen beeindruckende 148 aus diesem Bundesland. Insgesamt haben 3.652 von 10.754 Kommunen in Deutschland die Planung begonnen, wobei eine hohe Beteiligung in Nordrhein-Westfalen (72 Prozent), Saarland (64 Prozent) und Rheinland-Pfalz (52 Prozent) zu verzeichnen ist. Auf der anderen Seite sind Thüringen (11 Prozent), Sachsen und Bayern (jeweils 18 Prozent) hinter dem Durchschnitt zurück.
Regelungen und Fristen der Wärmeplanung
Die kommunale Wärmeplanung stellt einen zentralen Bestandteil der deutschen Klimapolitik dar. So müssen Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern ihre Wärmepläne bis Mitte 2026 vorlegen, während kleinere Kommunen bis Mitte 2028 Zeit haben. Diese Wärmepläne sollen Investitions- und Planungssicherheit für Eigentümer, Unternehmen und Kommunen schaffen. Gleichzeitig ist das Wärmeplanungsgesetz die Basis für das Heizungsgesetz, das den Einsatz erneuerbarer Energien im Heizungsbereich fördert.
Künftig werden strengere Regeln für den Einbau neuer Heizungen in Bestandsgebäuden gelten, die jedoch erst nach Vorlage einer kommunalen Wärmeplanung wirksam werden. Dabei sind Heizungen gefordert, einen Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie zu nutzen. Erlaubte Heizsysteme umfassen elektrische Wärmepumpen, Pellet- und Holzheizungen, Stromdirektheizungen, Solarthermie, Hybridheizungen und den Anschluss an das Fernwärmenetz. Auch Gasheizungen sind zulässig, wenn sie wasserstofftauglich sind.
Einige Kommunen äußerten jedoch Kritik an fehlenden gesetzlichen Regelungen, die das Handeln und die Datenerhebung erschweren. Der BDEW fordert klare und verlässliche Rahmenbedingungen und warnt vor einem „Zick-Zack-Kurs“ bei gesetzlichen Regelungen. 98 Prozent der Städte mit mehr als 45.000 Einwohnern haben mittlerweile mit ihren Wärmeplanungen begonnen oder diese abgeschlossen.
Finanzielle Unterstützung und Klimaziele
Das Wärmeplanungsgesetz, das am 1. Januar 2024 in Kraft tritt, verfolgt das Ziel, die Klimaziele bis 2045 zu erreichen. Alle Städte und Gemeinden in Deutschland sind verpflichtet, lokale Wärmeplanungen zu erstellen, die den Bürgern, Unternehmen und Energieversorgern Sicherheit hinsichtlich der zentralen Wärmeversorgung bieten. Großstädte müssen ihre Planung bis zum 30. Juni 2026 vorlegen, während größere Gemeinden bis zum 30. Juni 2028 Zeit haben.
Zur Unterstützung dieser Maßnahmen stehen 500 Millionen Euro bereit, die bis 2028 zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzierung erfolgt unbürokratisch über erhöhte Anteile an der Umsatzsteuer für die Länder. Die aktuellen Fortschritte in der Wärmeplanung sind ein Schritt in Richtung einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2045, wobei das Ziel besteht, 100 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien zu gewinnen.
Für den Erfolg der Wärmewende ist die Weiterentwicklung bestehender Förderrichtlinien, Gesetze und Verordnungen unerlässlich, und die Länder sind verpflichtet, die Erstellung der Wärmepläne sicherzustellen. Das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende spielt künftig eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Kommunen in diesem Prozess.