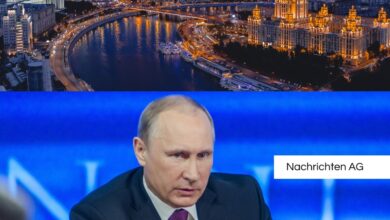Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) trat in einem hitzigen Schlagabtausch im Atom-Untersuchungsausschuss des Bundestages auf, um sich gegen Vorwürfe zu verteidigen, die Entscheidungen zum deutschen Atomausstieg und mögliche Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken betreffen. Die Befragung fand vor dem Hintergrund der anhaltenden Energiekrise und der Herausforderungen im Zuge des Ukraine-Kriegs statt. Habeck machte dabei klar, dass die Prüfung einer Laufzeitverlängerung im Jahr 2022 „ergebnisoffen und ohne Tabus“ war. Insbesondere die Versorgungssicherheit war für ihn die Richtschnur seines Handelns, wie er in der Sitzung betonte. Mit dieser Argumentation versuchte er, negative Vorurteile über die Handlungsweise seines Ministeriums zu entkräften.
Habeck unterstrich, dass seine Anordnung, die drei verbleibenden Atomkraftwerke länger zu betreiben, auf die angespannten Energieversorgungslage zurückzuführen war. Diese Situation war maßgeblich durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bedingt. Neben ihm kritisierte auch Olaf Scholz (SPD) in seiner Rolle als Kanzler die Vorgängerregierung für die gegenwärtige Gasmangellage, ohne dabei näher auf deren Ursachen einzugehen. Habeck wies darauf hin, dass die Atomkraftwerke in Deutschland keinen nennenswerten Beitrag zur Überwindung des Gasmangels leisten konnten und verwies zudem auf die Probleme mit Atomkraftwerken in Frankreich, die zu Stromengpässen führten.
Politische Spannungen in der Koalition
Im Oktober 2022 intervenierte Kanzler Scholz und ordnete an, die laufenden Atomkraftwerke bis zum 15. April 2023 weiter zu betreiben. Dies geschah nach gescheiterten Einigungsversuchen zwischen Habeck und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Während Habeck einer kurzen Verlängerung positiv gegenüberstand, forderte Lindner eine umfassendere Lösung. Scholz lehnte zudem eine Bestückung der Atomkraftwerke mit neuen Brennstäben ab. Diese politischen Differenzen werfen ein Licht auf die internen Spannungen in der Ampel-Koalition.
Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass die CDU/CSU Habeck ein „groß angelegtes Täuschungsmanöver“ vorwirft. Die Union unterstellt ihm, dass er Bedenken gegen die Abschaltung der Atomkraftwerke in den Grünen-geführten Ministerien ignoriert habe. Diese Vorwürfe wurden von Habeck scharf zurückgewiesen. Er betonte die ergebnisoffene Prüfmethode und wandte sich gegen den Vorwurf einer ideologischen Vorfestlegung.
Schlussfolgerungen und Ausblick
Der Ausschuss hat die Aufgabe, die Entscheidungsprozesse zur Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke zu überprüfen. Der Abschlussbericht soll im Februar 2025 vorgelegt werden und wird individuelle Statements der verschiedenen Fraktionen enthalten. In Anbetracht der gesellschaftlichen Debatte, die der Ausstieg aus der Atomkraft seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 ausgelöst hat, bleibt die Diskussion um die Energieversorgung Deutschlands und die Nutzung von Atomkraft hochaktuell. Bis zum 15. April 2023 liefen die letzten drei Atomkraftwerke (Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2) im befristeten Streckbetrieb, ohne neue Brennelemente zu verwenden, und segniten einen symbolischen Schlussstrich unter ein für Deutschland zentrales Kapitel der Energiepolitik.