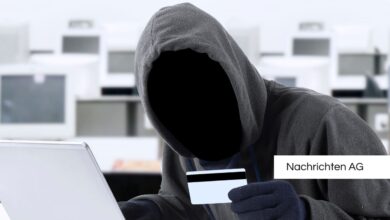Die Erinnerung an die dunklen Kapitel der DDR-Geschichte ist nach wie vor prägend. Besonders das Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) drückt wie ein Schatten auf die Gesellschaft. Das ostdeutsche Geheimdienstsystem, gegründet 1950 als „Schild und Schwert der Partei“, diente der Sozialistischen Einheitspartei (SED) zur Einschüchterung und Kontrolle der Bevölkerung. Es beschäftigte schätzungsweise 91.000 hauptamtliche und bis zu 189.000 inoffizielle Mitarbeiter, die für ein besonders dichtes Überwachungsnetz sorgten – ein Stasi-Mitarbeiter kam auf 180 Bürger im Vergleich zu 1:567 in der Sowjetunion. Diese Struktur hatte verheerende Auswirkungen auf die Lebensrealität der Menschen in der DDR und führte zu zahlreichen zerstörten Schicksalen.
Neueste Untersuchungen der Berliner Charité belegen die schwerwiegenden physischen und psychischen Erkrankungen bei ehemaligen Stasi-Opfern, die signifikant höher sind als in der Allgemeinbevölkerung. Das Leid, das die Stasi über die Menschen brachte, ist tief verwurzelt, und viele Überlebende kämpfen bis heute mit den Folgen ihrer Erfahrungen. Stefan Donth, Leiter des Zeitzeugenarchivs der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, hebt hervor, wie wichtig es ist, aus diesen Erfahrungen zu lernen und die Geschichte aufzuarbeiten.
Die Verantwortung der Ehemaligen
In der Reflexion über ihre Vergangenheit zeigen sich die ehemaligen Stasi-Mitarbeiter ambivalent. Jochen Girke, einst Dozent für Operative Psychologie an der Stasi-Hochschule in Golm, gibt zu, er sei durch Umstände in die Stasi geraten und habe sich ideologisch gerechtfertigt gefühlt. „Ich hatte ein diffuses Feindbild“, sagt er und ergänzt, dass er seit 35 Jahren mit den Folgen seiner Entscheidungen kämpft. Girke ist eine Ausnahme unter den Ehemaligen, die sich mit ihrer Rolle auseinandersetzen.
Oliver Laudahn hingegen trat der Stasi aus Bequemlichkeit bei. Aufgewachsen in einem Umfeld, das der Stasi nahestand, sah er sie nicht als Bedrohung. Laudahn wurde als Student zum Spitzel ausgebildet und entwickelte ein stark vereinfachtes Weltbild. Bernd Roth, der bis zum Major aufstieg, war sich der wirtschaftlichen Probleme der DDR bewusst, aber auch er handelte aus finanziellen Gründen. Roth erlebte den Fall der Mauer und war von der Unkenntnis der Stasi über gesellschaftliche Entwicklungen überrascht.
Die Folgen der Überwachung
Die Ausmaße politischer Verfolgung in der DDR sind enorm. Schätzungen von 170.000 bis über 300.000 politisch Verfolgten zwischen 1945 und 1989 dokumentieren das Ausmaß der Einschüchterung durch die Stasi. Besonders gravierend waren die Methoden der „Zersetzung“, die gezielt darauf abzielten, das Selbstwertgefühl von Oppositionsmitgliedern zu untergraben. Die Methoden umfassten das Eindringen in persönliche Beziehungen und die Verbreitung von Gerüchten, was zu massiven psychischen Belastungen führte.
Die gesellschaftliche Anerkennung der Opfer politischer Verfolgung wird oft als unzureichend wahrgenommen. Ein beunruhigendes Bild zeigt sich auch in den psychischen Folgen: Studien belegen, dass ein Drittel der ehemaligen politischen Inhaftierten auch 26 Jahre nach der Wiedervereinigung an posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) leidet. Die Nachkommen dieser Betroffenen zeigen ebenfalls signifikant höhere Belastungen in psychischen Störungsbereichen.
In der Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit gibt es positive Ansätze, wie beispielsweise die Initiative für einen „Campus der Demokratie“ auf dem Gelände der ehemaligen MfS-Zentrale, die von Roland Jahn angeregt wurde. Diese Maßnahmen sollen die Erinnerungskultur und die Aufarbeitung fördern und die Lehren aus der Geschichte betonen.
Wie die Ereignisse um die Stasi zeigen, ist der Weg zur vollständigen Aufarbeitung noch lange nicht zu Ende. Die Stimmen der ehemaligen Mitarbeiter und die der Opfer müssen gehört werden, um ein umfassendes Bild dieser herben Erfahrungen zu zeichnen und um eine Kultur des Erinnerns zu fördern.