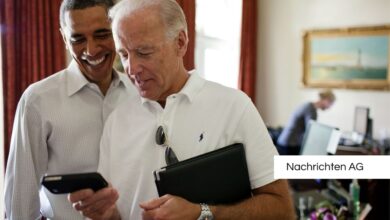Die Energiewende in Deutschland steht vor bedeutenden Veränderungen, insbesondere im Heizungsbereich. Grundstückseigentümer sind gefordert, sich intensiv mit dem neuen Heizungsgesetz auseinanderzusetzen. Mit dem Inkrafttreten der kommunalen Wärmeplanung dürfen bei einem Heizungstausch künftig keine reinen fossilen Heizsysteme mehr verwendet werden. Alternative Möglichkeiten wie Fernwärme oder Nahwärme werden immer häufiger zur Pflicht, was jedoch von vielen als kostspielig und zeitaufwendig empfunden wird. Merkur berichtet, dass beispielsweise Städte wie Mannheim und Augsburg bereits planen, ihre Gasleitungen abzuschreiben.
Ein zentraler Aspekt der neuen Regelungen ist der sogenannte Anschlusszwang. In Thüringen haben bereits 17 Kommunen diesen beschlossen, während auch andere Städte wie Dachau in Bayern und Frankfurt in Hessen ähnliche Überlegungen anstellen. Die Verbindung zu einer Fernwärmeversorgung könnte für Bürger verpflichtend werden, um die Investitionskosten zu decken. Die Anschlusskosten variieren dabei zwischen 8000 und 15000 Euro und beinhalten die Entsorgung alter Heizungsanlagen.
Wärmeplanungsgesetz und Klimaziele
Das eine zentrale Rolle spielende Wärmeplanungsgesetz wird am 1. Januar 2024 in Kraft treten, mit dem Ziel, die Klimaziele bis 2045 zu erreichen. Alle Städte und Gemeinden sind verpflichtet, eine lokale Wärmeplanung zu erstellen, wobei große Städte bis zum 30. Juni 2026 und kleinere Gemeinden bis zum 30. Juni 2028 Zeit haben. Diese Pläne sollen den Bürgern, Unternehmen und Energieversorgern Sicherheit über die zentrale Wärmeversorgung bieten. Laut der Bundesregierung wird der Bund die Wärmeplanung mit 500 Millionen Euro bis 2028 unterstützen.
Das Gesetz zielt darauf ab, insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung zu beschleunigen. Derzeit werden etwa 14 Prozent der Haushalte in Deutschland mit Fernwärme versorgt, wovon lediglich 20 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen. Bis 2040 soll der Anteil an Erneuerbaren Energien in den Wärmenetzen auf 80 Prozent steigen. Die Verbraucherzentralen setzen sich zudem dafür ein, die Bedingungen für den Anschluss an Fernwärmesysteme attraktiver zu gestalten, um so den Anschlusszwang zu minimieren.
Langfristige energiepolitische Ausrichtung
Unterstützend zur Wärmeplanung verfolgt Deutschland ambitionierte Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Laut dem Bundesklimaschutzgesetz soll bis 2045 Treibhausgasneutralität erreicht werden. Hierbei sind Zwischenziele von 65 Prozent weniger Emissionen bis 2030 und 88 Prozent weniger bis 2040 im Vergleich zu 1990 festgelegt worden.
Zu den Maßnahmen zählen der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 sowie der forcierte Ausbau erneuerbarer Energien. Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch soll bis 2030 auf mindestens 80 Prozent erhöht werden, während neue Infrastrukturprojekte, wie die Wasserstoffinfrastruktur, bis 2028 verstärkt vorangetrieben werden. In einer sich wandelnden Energieversorgung wird der Fokus zunehmend auf umweltfreundliche und nachhaltige Lösungen gelegt, die sowohl die Energiewende als auch die kommunale Wärmeverbrauchsplanung miteinander verknüpfen.