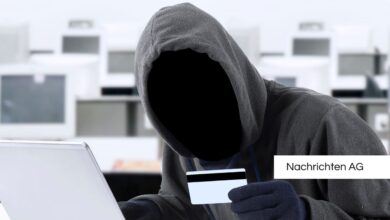Am 17. Februar 2025 beginnt im Frankfurter Landgericht der Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder eines kriminellen Clans aus Berlin. Die Angeklagten, eine Frau und ihre beiden Brüder, sehen sich wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs konfrontiert. Die Vorwürfe beinhalten einen dramatischen Vorfall, der sich am 30. September 2023 ereignete, als die Brüder den getrennt lebenden Ehemann der Schwester in einer gemeinsamen Wohnung in Frankfurt überwältigten und fesselten.
Unter den Details des Verbrechens sticht besonders die brutalste Foltermethode hervor: das Waterboarding. Der Mann wurde für zwei Stunden gefoltert, wobei ihm viermal Wasser über ein Tuch auf Mund und Nase gegossen wurde. Dies führte zu Todesangst und einem erzwungenen finanziellen Entgegenkommen; der Geschädigte überwies letztendlich 10.000 Euro, um die Forderung eines Zugewinnausgleichs von 45.000 Euro zu erfüllen. Die brutale Vorgehensweise reflektiert die Gewalt, die oft mit Clan-Kriminalität in Verbindung gebracht wird.
Clan-Kriminalität in Deutschland
Clan-Kriminalität ist ein bedeutsames Phänomen in Deutschland, insbesondere in städtischen Zentren wie Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Laut dem Bundeskriminalamt (BKA) wird Clan-Kriminalität als ethnisch abgeschottete, hierarchisch organisierte Subkultur beschrieben. Die mediale Bezeichnung „Clan“ ist umstritten. Wissenschaftler, wie Mahmoud Jaraba von der Universität Erlangen-Nürnberg, warnen davor, dass diese Bezeichnung eine vielschichtige Realität stark vereinfacht. Jaraba argumentiert, dass die kriminellen Strukturen oft von kleineren, engsten Familienangehörigen organisiert werden, die in einer Art und Weise handeln, die von außen als „clanartig“ wahrgenommen wird.
Eine Übersicht über die Verbreitung von Clan-Kriminalität zeigt, dass in Deutschland 0,6 % aller Straftaten der Clan-Kriminalität zugeschrieben werden. In Berlin, einer der Hauptstädte der Clan-Kriminalität, liegt dieser Wert bei 0,2 %. Der tatsächliche Einfluss dieser Gruppen auf die Kriminalitätsstatistik ist somit eher gering, jedoch wird die Wahrnehmung der Bedrohung in der Öffentlichkeit und die damit verbundene Angst oft als hoch eingeschätzt.
Die gesellschaftlichen Auswirkungen
Die Aktivitäten solcher kriminellen Clans sind vielfältig: Drogenhandel, Prostitution, Schutzgelderpressung und Diebstahl sind nur einige der illegalen Geschäfte, die berichtet werden. Nach der Flüchtlingskrise 2015/2016 haben viele dieser Clanstrukturen Flüchtlinge rekrutiert, um im Drogenhandel tätig zu werden. Die Polizei hat reagiert, indem sie regelmäßige Kontrollen und Razzien, insbesondere in Shisha-Bars und örtlichen Geschäften, durchgeführt hat.
Obwohl die Polizei in einigen Bundesländern spezifische Maßnahmen gegen Clan-Kriminalität ergreift, wie die „Politik der 1.000 Nadelstiche“, gibt es auch Kritiker, die die Effektivität dieser Strategien in Frage stellen. Daniela Hunold, Criminologist, betont, dass die Verwendung von ethnischen Gruppen in polizeilichen Strategien rechtlich problematisch sein könnte. Ohnehin zeigt die Forschung, dass viele Angehörige dieser Clans nicht kriminell sind und gegen ihre eigenen Mitglieder vorgehen möchten, die sich in der Öffentlichkeit schlecht benehmen.
Clan-Kriminalität bleibt ein komplexes und oft sensationalisiertes Thema in der deutschen Gesellschaft. Die aktuellen Anklagen in Frankfurt sind ein Beispiel für die brutalsten Auswüchse dieser Organisierten Kriminalität, wobei die sozialen und rechtlichen Herausforderungen für die Strafverfolgung und die Gesellschaft weiterhin bestehen. Die Diskussion um Klärung, Prävention und rechtliche Handlungsansätze ist wichtiger denn je.
Zur weiteren Vertiefung der Thematik über Clan-Kriminalität und deren Auswirkungen in Deutschland siehe auch die Berichte von op-online.de, dw.com und die umfassenden Informationen auf Wikipedia.