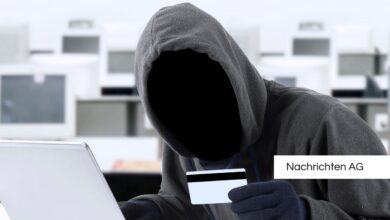Am 25. Februar 2025 hat der Deutsche Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit ein wichtiges Sondervermögen für die Verteidigung verabschiedet. Diese Entscheidung ist Teil eines dringenden Plans zur Stärkung der deutschen Verteidigungskapazitäten im mittelfristigen Zeitraum. Der erste Schritt in diese Richtung wurde bereits vor drei Jahren nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs mit einem ersten Sondervermögen unternommen, dessen Auswirkungen nun spürbar werden.
Die Wahrnehmung der äußeren Sicherheit in Deutschland hat sich in den letzten Jahren erheblich verschlechtert. Diese Verschlechterung wird als vornehmliche Bedingung für ein geregeltes Staatswesen anerkannt. In diesem Kontext betrachten viele Entscheidungsträger die zusätzliche Staatsverschuldung für die Gewährleistung der äußeren Sicherheit als gerechtfertigt. Dabei bedeutet die Befürwortung eines zweiten Sondervermögens nicht, dass die Schuldenbremse dauerhaft außer Kraft gesetzt wird.
Politische Reaktionen
Die Reaktionen der politischen Parteien auf die anhaltende Diskussion über die Verteidigungsausgaben sind unterschiedlich. Die AfD fordert eine Erhöhung des Verteidigungsetats, bemängelt jedoch die derzeitige materielle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, die trotz regulären Haushaltsmitteln von 52 Milliarden Euro und 100 Milliarden Euro an Sonderverschuldung nicht gegeben sei. Dies zeugt von der Notwendigkeit strategischer Autonomie in Europa, die laut AfD noch nicht erreicht ist.
Die Grünen unter Leitung von Sara Nanni äußern, dass die Bundeswehr die wachsenden Verteidigungsaufgaben nicht erfüllen könne. Sie fordern eine nachhaltige personelle, materielle und finanzielle Ausstattung und plädieren dafür, dass Deutschland mehr als zwei Prozent des BIP in Verteidigung investieren sollte. Dies soll durch eine politische Einigung zur Umsetzung der NATO-Verteidigungsplanung geschehen.
Die Union, vertreten durch Dr. Johann David Wadephul von der CDU, kritisiert die Ampelregierung für unzureichende Investitionen in die Verteidigung. Wadephul unterstützt das Sondervermögen und strebt eine Erhöhung des Verteidigungsetats im Bundeshaushalt an, mit einem klaren Ziel von mindestens zwei Prozent des BIP, wobei er persönlich sogar drei Prozent für die nächste Legislaturperiode in Betracht zieht. Seine CSU-Kollegen fordern ebenfalls eine Erhöhung des Verteidigungsetats, um eine glaubwürdige Abschreckung gegenüber Russland zu signalisieren.
Die FDP setzt sich für die Verstetigung der Verteidigungsausgaben mit einer Untergrenze von zwei Prozent ein und orientiert sich an den NATO-Zielen. Der Koalitionspartner SPD hat bereits eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des BIP bekanntgegeben und möchte die nachhaltige Finanzierung in der Zukunft sicherstellen.
EU-weite Verteidigungsausgaben im Fokus
Auf EU-Ebene zeigt die NATO einen ausgeprägten Trend zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Die NATO-Staaten planen für 2024, etwa 2,71% ihres BIP auszuwenden, was insgesamt etwa 1,5 Billionen US-Dollar entspricht. Dies stellt eine bemerkenswerte Steigerung von 10,9% im Vergleich zum Vorjahr dar, während die europäischen Alliierten und Kanada 2,02% ihres BIP aufbringen sollen. Diese Entwicklung ist vor allem eine Reaktion auf die veränderte Bedrohungswahrnehmung durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
Deutschland plant, im Jahr 2024 Verteidigungsausgaben von 2,12% des BIP zu erreichen, einschließlich eines Sondervermögens von 100 Milliarden Euro, das nahezu vollständig für Großgeräte eingeplant ist. Die politischen Entwicklungen und die getätigten Investitionen sind auch vor dem Hintergrund der NATO-Ziele zu sehen, die 2002 und 2014 die verbindliche Vereinbarung von zwei Prozent des BIP für Verteidigung festlegten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bundestag einen konkreten Schritt in Richtung einer stärkeren deutschen Verteidigung unternommen hat, während politische Akteure in den verschiedenen Parteien wie AfD, Grüne, CDU/CSU, FDP und SPD diverse Perspektiven und Lösungen für die künftige Verteidigungsfinanzierung erörtern. Die öffentlichen Diskussionen könnten somit die Richtung bestimmen, die Deutschland im Kontext der NATO-Verpflichtungen und gegenwärtigen geopolitischen Herausforderungen einschlagen wird.