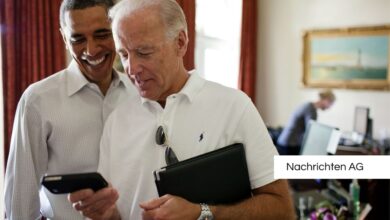Die Debatte um die Entwicklung parlamentarischer Demokratien wird am 29. April 2025 in der Urania Berlin erneut aufgegriffen. Im Rahmen der Gesprächsreihe „Futuring the Liberal Script“ werden Natascha Freundel, Journalistin und Redakteurin beim Rbb-radio3, sowie Philipp Lepenies, Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, über den Übergang zur parlamentarischen Demokratie in England, den USA und Frankreich ab dem 18. Jahrhundert diskutieren. Für den Dialog, der um 19:30 Uhr beginnt, sind Eintrittspreise von 8 Euro (ermäßigt 5 Euro) vorgesehen. Dies wird ein Teil der fortlaufenden Auseinandersetzung über die Herausforderungen und Krisenerscheinungen liberaler Demokratien sein, die seit 2021 im Rahmen dieser Reihe behandelt werden. Die Freie Universität Berlin hebt hervor, dass die Demokratie ständige Erneuerung und Legitimation durch die Bürger*innen und gewählte Vertreter*innen erfordert.
Sich mit der Zerbrechlichkeit parlamentarischer Demokratie auseinanderzusetzen, ist von zentraler Bedeutung, da diese Systeme immer wieder durch verschiedene historische Bedrohungen herausgefordert werden. Lepenies, dessen Forschungsschwerpunkte auf Nachhaltigkeit, Entwicklung und sozialer Kohäsion liegen, und seine Diskussionspartnerin Freundel werden diesen Aspekt beleuchten und die Lehren der Geschichte in den Kontext der heutigen politischen Landschaft stellen.
Historischer Kontext der parlamentarischen Demokratie
Die Entstehung moderner Demokratien ist stark von den sozialen Bewegungen des 18. und 19. Jahrhunderts geprägt. Zur Zeit der Französischen Revolution mobilisierten breite Bevölkerungsschichten, darunter Frauen und verschiedene soziale Klassen, ihre Forderungen nach politischer Teilhabe. Im Unterschied zur Amerikanischen Revolution, die relativ früh zu einer stabilen republikanischen Ordnung führte, war die Französische Revolution von Gewalt geprägt und führte letztendlich zum Regime Napoleons. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg beschreibt, dass sowohl die amerikanische als auch die französische Revolution das Ziel hatten, alte Hierarchien zu hinterfragen.
Die Verfassungen und Parlamente, die in Europa im Zuge dieser Umwälzungen entstanden, legten die Grundsteine moderner Demokratie. Dennoch sahen sich demokratische Bestrebungen im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts oft einer massiven Unterdrückung ausgesetzt. In Frankreich kam es zu einem Wechsel der politischen Herrschaft, während in Deutschland die Flössen der Revolutionäre bis zur Paulskirchenversammlung 1848 nur begrenzte Erfolge erzielten. Diese Versammlung markierte den Versuch eines ersten gesamtdeutschen Parlaments, das jedoch nicht dauerhaft zur Durchsetzung von Demokratie führte.
Die Entwicklung der Demokratie in Deutschland
In Deutschland wuchs die Verzweigung zwischen Monarchie und den Bestrebungen nach parlamentarischer Mitbestimmung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918. Der Weg zur Demokratie war holprig. Monarchen konnten Parlamente auflösen und blieben der Oberbefehlshaber des Militärs, was die Verankerung demokratischer Strukturen erschwerte. So war das Dreiklassenwahlrecht in Preußen bis 1918 ein Symbol für die Ungleichheit im politischen System, wohingegen einige Bundesländer wie Baden und Württemberg fortschrittlichere Wahlrechte und Verfassungen hatten, die bereits demokratische Prozesse ermöglichten.
Die Weimarer Republik von 1918 bis 1933 stellte schließlich den ersten Versuch dar, eine Demokratie auf deutschem Boden mit allgemeinem, gleichen, unmittelbaren und geheimen Wahlrecht für Männer und Frauen zu etablieren. Diese Errungenschaften mussten jedoch im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wieder gegen große Herausforderungen und historische Rückschläge verteidigt werden. Am Ende des Zweiten Weltkriegs war der Wiederaufbau der Demokratie in Deutschland geprägt von den Lehren aus der Vergangenheit, was 1949 zur Verabschiedung des Grundgesetzes führte, das die rechtlichen Rahmenbedingungen für die deutsche Demokratie festlegte.
Die Veranstaltung am 29. April wird somit nicht nur eine reflexive Auseinandersetzung mit der parlamentarischen Demokratie in der Vergangenheit sein, sondern auch eine notwendige Diskussion darüber anstoßen, wie diese Systeme im Hinblick auf ihre Fragilität in der Gegenwart und Zukunft herausgefordert werden können.