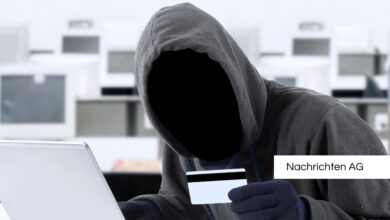Die Geschichte Ludwig Marums ist die eines konsequenten Sozialdemokraten und leidenschaftlichen Kämpfers für die Weimarer Demokratie. Geboren am 5. November 1882 in Frankenthal, Pfalz, wuchs Marum in einer sephardischen Familie auf, die aus Spanien geflohen war. Er war ein Jurist und verfolgte bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten eine aktive politische Karriere, die ihn bis in den Reichstag führte.
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg und München wurde Marum 1908 als Anwalt in Karlsruhe zugelassen. Im Jahr 1928 wurde er Reichstagsabgeordneter und setzte sich für soziale Gerechtigkeit und die Demokratisierung Deutschlands ein. Seine politischen Bestrebungen waren untrennbar mit seinem jüdischen Erbe verbunden. Marum war ein aktiver Gegner des Nationalsozialismus, was schließlich zu seiner Verhaftung im März 1933 führte, als er unter Verletzung seiner parlamentarischen Immunität festgenommen wurde.
Gewaltsamer Tod im KZ Kislau
Nach seiner Verhaftung wurde Ludwig Marum im Konzentrationslager Kislau bei Bruchsal interniert. Dort wurde er am 29. März 1934 ermordet. Sein lebloser Körper wurde angeblich am Fensterkreuz seiner Einzelzelle gefunden, und es wurde versucht, den Vorfall als Selbstmord darzustellen. Doch in der Bevölkerung herrschte der Glaube, dass Marum sich nicht selbst das Leben genommen hat. Der Mord wurde auf Befehl von Reichsstatthalter Robert Wagner durchgeführt und am 3. April 1934 von über 3.000 Menschen bei seiner Beisetzung betrauert.
Der letzte Brief, den Ludwig Marum aus dem KZ schrieb, war von Hoffnung geprägt. Trotz seines zermürbenden Schicksals hielt er an seinen Überzeugungen fest und wollte sein Ehrenwort nicht brechen, als ihm während eines zweitägigen Freigangs die Möglichkeit zur Flucht geboten wurde.
Familie und Nachwirkungen
Ludwig Marum war verheiratet mit Johanna Benedick, mit der er drei Kinder hatte: Elisabeth, Hans Karl und Eva Brigitte. Nach seinem Tod flohen Johanna und ihre Tochter Brigitte nach Paris, während Elisabeth in Berlin blieb. Tragischerweise wurde Eva Brigitte später in das Vernichtungslager Sobibor deportiert und ermordet. Marums Geschichte ist nicht nur die eines Mannes, sondern spiegelt die Schicksale seiner Familie und die Verfolgung und Dramatik der jüdischen Gemeinschaft in dieser Zeit wider.
Die Nachwirkungen von Marums Leben und Ermordung sind bis heute spürbar. Er wurde posthum mit verschiedenen Ehrungen und Gedenkstätten gewürdigt, darunter Straßenbenennungen und der Ludwig-Marum-Preis. Eine Gedenktafel wurde 2014 in Bruchsal enthüllt, um an ihn zu erinnern. Des Weiteren gibt es mehrere Wanderausstellungen, wie „Ludwig Marum – Mensch. Politik. Opfer“, die seine Lebensgeschichte und sein Erbe darstellen. Diese Ausstellungen, organisiert von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und dem Landesarchiv Baden-Württemberg, betonen Marums unverzichtbaren Beitrag zur sozialdemokratischen Bewegung und zur parlamentarischen Demokratie in Baden.
Ludwig Marum ist ein Symbol für den Widerstand gegen Unterdrückung und das Streben nach sozialer Gerechtigkeit in einer dunklen Zeit der deutschen Geschichte. Seine Biographie erzählt nicht nur von persönlichem Mut, sondern auch von den Herausforderungen und dem unermüdlichen Einsatz für die Ideale der Aufklärung und Toleranz.