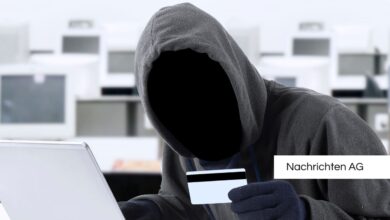Am Mittwoch, dem 2. April 2025, fand eine bedeutende Verhandlung vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof statt, bei der der umstrittene Gesetzentwurf der Initiative „Berlin autofrei“ im Mittelpunkt stand. Diese Initiative verfolgt das Ziel, den motorisierten Individualverkehr innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings nahezu vollständig zu verbieten. Laut Tagesspiegel soll durch diese Maßnahme die Reduzierung des privaten Autoverkehrs im Stadtzentrum um bis zu 80 Prozent erreicht werden.
Der Entwurf sieht die Einführung eines neuen Straßentyps namens „Autoreduzierte Straße“ vor, der zwischen Fußgängerzone und normaler Straße positioniert ist. Nach einer Übergangszeit von vier Jahren dürfen in diesen Bereichen Fahren und Parken nur noch eingeschränkt erlaubt sein. Privatpersonen sollen lediglich ein Kontingent von maximal zwölf Fahrten pro Jahr beanspruchen können, wobei bei Zuwiderhandlungen hohe Geldbußen von bis zu 100.000 Euro drohen könnten. Nach der Übergangszeit soll die Nutzung eines privaten PKWs auf nur noch sechs 24-Stunden-Zeiträume pro Jahr reduziert werden. Ausnahmen gelten für wichtige Dienstleistungen wie Müllabfuhr und Rettungsdienste, wobei auch Härtefallregelungen für bestimmte Berufsgruppen in Betracht gezogen werden, die auf den Autoverkehr angewiesen sind.
Rechtliche Bedenken
Die Innenverwaltung Berlins beäugt den Gesetzentwurf kritisch und hält ihn für nicht mit höherrangigem Recht vereinbar. Insbesondere befürchtet der Senat, dass das neue Regelwerk einen schwerwiegenden Eingriff in die Handlungsfreiheit darstellt. Dies könnte für viele Berufsgruppen – wie etwa Handwerker, Autowerkstätten und große Märkte – weitreichende Konsequenzen haben. Sollte das Gesetz als verfassungswidrig erachtet werden, würde dies das Ende der Initiative bedeuten, erklärt ein Sprecher der Initiative Berliner Zeitung.
Das Verfassungsgericht hat nun bis zu drei Monate Zeit, um über die Rechtmäßigkeit des Gesetzentwurfs zu urteilen. Eine Richterin stellte während der Verhandlung die Frage nach dem Anspruch auf die Nutzung eines Autos, was möglicherweise auf eine tiefere Auseinandersetzung mit den Grundlagen eines solchen Verbots hinweist.
Gesellschaftliche Auswirkungen
Bereits 2021 hatte die Initiative über 50.000 Unterschriften gesammelt, um das Volksbegehren einzuleiten. Der Plan ist Teil eines größeren städtebaulichen Vorhabens, das durch den Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr 2030, auch bekannt als StEP MoVe, unterstützt wird. Dieses Programm zielt darauf ab, die Verkehrspolitik in Berlin klimafreundlicher zu gestalten und den Anteil aller Wege im Umweltverbund bis 2030 auf mindestens 82 Prozent zu erhöhen. Der Anstieg des Radverkehrs und der Rückgang des motorisierten Individualverkehrs sind bereits bemerkbare Trends – so sank der Anteil des Individualverkehrs von 33 % im Jahr 2008 auf 26 % im Jahr 2018. Dies hat Berlin bei der Verlagerung auf umweltfreundlichere Mobilität einen Schritt nähergebracht, wie Berlin.de berichtet.
Die Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof ist nicht nur ein juristisches, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis, das die künftige Verkehrspolitik Berlins maßgeblich beeinflussen könnte. Während die Initiative um die Unterstützung der Öffentlichkeit wirbt, zeigt sich der Senat skeptisch gegenüber der Umsetzbarkeit der weitreichenden Maßnahmen. Diese Diskussion über die Mobilität der Zukunft wird sicherlich auch weiterhin im Mittelpunkt der politischen Debatte in der Stadt stehen.