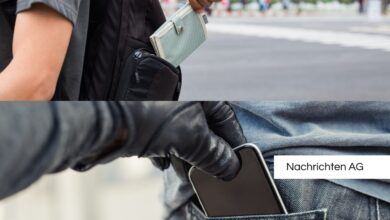Im Totschlagsprozess gegen Habib A., der wegen seiner mutmaßlichen Belästigungen und einer tödlichen Attacke vor Gericht steht, schilderten am vergangenen Donnerstag Mädchen und Frauen ihre erschütternden Erfahrungen. Die Anhörungen, die ein eindrückliches Bild der wiederholten und brutalen Belästigungen zeichnen, werfen ein besorgniserregendes Licht auf das Verhalten des Angeklagten, der sich in den Wochen vor der Tat als Stalker geriert hatte. So berichtete eine 39-jährige Frau von einem Vorfall, der sich an einem Spätsommertag Anfang September 2024 in Aue ereignete. Sie hatte gerade ihre Arbeitsstelle verlassen, um eine Mittagspause einzulegen, als sie bemerkte, dass sie von einem unbekannten Mann beobachtet wurde. Verunsichert wechselte sie die Straßenseite, jedoch folgte ihm der Mann beharrlich.
Die Schilderungen der Frauen machen klar, dass der Angeklagte eine immer gleiche Vorgehensweise an den Tag legte. In sozialen Medien wurde vor ihm gewarnt, was darauf hindeutet, dass er bereits zuvor bei anderen Frauen für Besorgnis gesorgt hatte. Der Aufruf in den sozialen Netzwerken, das Bild des Mannes zu verbreiten, ist ein Beispiel dafür, wie aktuelle Technologien zur Nachverfolgung von Belästigern beitragen können, aber auch die Gefahren, die mit deren Nutzung einhergehen.
Gesellschaftliche Dimension von digitaler Gewalt
Das Phänomen digitaler Gewalt bekommt in diesem Kontext eine neue Dimension. Laut einer Richtlinie des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2024 wird digitale Gewalt als ein ernstzunehmender Gewaltakt definiert, der durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien an Wirkungsmacht gewinnt. Viele Betroffene, insbesondere junge Frauen, erleben sowohl digitale als auch analoge Gewalt von denselben Tätern. Diese Realität zeigt, dass digitale Gewalt oft in physische Übergriffe mündet, wie im Fall von Habib A. zu beobachten ist.
Digitale Gewalt umfasst dabei eine Vielzahl von Formen, darunter Cybermobbing, Cyberstalking und digitale Überwachung. Der Deutsche Juristinnenbund hebt hervor, dass diskriminierende Algorithmen und Technologien wie Spionage-Apps eine neue Dimension der Einschüchterung schaffen. Diese Art der Gewalt ist nicht nur geschlechtsspezifisch, sondern auch tief in den sozialen Nahraum eingebettet, was eine zusätzliche Herausforderung für die Rechtsprechung mit sich bringt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, technische Restriktionen und die Verantwortung der Plattformanbieter zu diskutieren und zu fördern.
Interventionen und rechtliche Rahmenbedingungen
Die rechtliche Basis hat sich in den letzten Jahren bereits verbessert; Lücken bleiben jedoch weiterhin bestehen. Interventionen nach erlebter digitaler Gewalt müssen spezifische Symptome und Folgen berücksichtigen. Berater*innen benötigen technisches Know-how, um digitale Gewalt zu erkennen und dokumentieren zu können. Zudem ist die Diskussion über Klarnamenpflicht im Internet und technische Maßnahmen gegen heimliches Fotografieren von zentraler Bedeutung, um die Sicherheit von Frauen und Transpersonen zu gewährleisten.
Es ist offensichtlich, dass die Sicherheit von Frauen im digitalen und analogen Raum ernsthaft gefährdet ist. Die Ereignisse rund um die Belästigungen durch Habib A. verdeutlichen eindringlich die Dringlichkeit, gewaltsame Übergriffe, sowohl analog als auch digital, umfassend zu bekämpfen. Die Sensibilisierung für dieses Thema und rechtliche Fortschritte sind unerlässlich, um die betroffenen Frauen zu unterstützen und ihnen Sicherheit zu bieten.