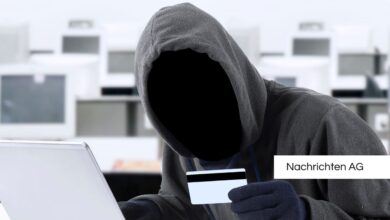Die Diskussion um die Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete in Deutschland gewinnt zunehmend an Fahrt. Während der Corona-Pandemie hat sich die Akzeptanz von Kartenzahlungen in deutschen Geschäften zwar erhöht, viele Läden bestehen jedoch nach wie vor auf Barzahlung oder erlauben Kartenzahlung nur ab einem bestimmten Betrag. Diese Bedingungen kommen besonders in den Fokus, da die neue Bezahlkarte eine Bargeldobergrenze von lediglich 50 Euro setzt.
Die Kritik an diesem System wird laut, insbesondere von Politikerinnen und Politikern der Grünen. Mona Sandhas, Vorsitzende der Partei in Hannover, hebt hervor, dass die Bargeldobergrenze als diskriminierend empfunden wird und die Integration von Geflüchteten erheblich behindern könnte. Gleichzeitig zeigen aktuelle Berichte, dass in Bundesländern wie Bayern die Bezahlkarte nur in bestimmten Geschäften und innerhalb eines festgelegten geografischen Rahmens genutzt werden kann.
Kritik und Proteste
Erhebliche Bedenken werden auch von der Initiative „Nein zur Bezahlkarte“ laut, die bundesweit zu Protestaktionen aufruft. In vielen Städten haben sich Tauschzirkel etabliert, in denen Bürger Bargeld gegen Gutscheine tauschen, die mit der Bezahlkarte erworben wurden. Diese Tauschgeschäfte werden als legale Umgehung der Bargeldobergrenze angesehen, obwohl sie von manchen Politikern als „Tricks“ abgetan werden.
In Städten wie Regensburg und Hamburg stellen lokale Parteien ihre Räumlichkeiten für diese Tauschzirkel zur Verfügung. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay unterstützt diese zivilgesellschaftlichen Initiativen, die darauf abzielen, bestehende Integrationshindernisse zu überwinden. Ein weiterer Aspekt der Diskussion ist die Entscheidung des Bundesrates, eine Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes zur Regelung der Bezahlkarte zu genehmigen.
Regelungen und Hintergründe
Nach den neuen Bestimmungen haben Geflüchtete, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, künftig Anspruch auf die Bezahlkarte, die als neue Form der Leistungen eingeführt wurde. Dies geschah durch eine Gesetzesänderung, die am 1. März 2024 beschlossen und am 16. Mai 2024 in Kraft trat. Zuvor durften in Gemeinschaftsunterkünften vor allem Sachleistungen ausgezahlt werden, während außerhalb vorwiegend Bargeld bereitgestellt wurde. Die Reform erlaubt es Ländern und Kommunen, flexibler mit diesen Leistungen umzugehen.
Ziel der Bezahlkarte ist es, die Überweisungen von Nichtdeutschen an ihre Heimatländer zu erschweren. Im Jahr 2022 überwiesen Migranten und Geflüchtete nach Angaben der Bundesbank über sieben Milliarden Euro aus Deutschland ins Ausland. Diese Zahl zeigt, wie wichtig Rücküberweisungen aus Deutschland für die Wirtschaft in den Herkunftsländern sind, da sie einen stabilen Einkommensfluss darstellen. Die Bundesbank schätzt die Geldtransfers und veröffentlicht regelmäßig Berichte über „Heimatüberweisungen der Gastarbeiter“.
Experten argumentieren, dass diese Rücküberweisungen nicht nur der Armutsbekämpfung dienen, sondern auch als entscheidender Stabilitätsfaktor in den Herkunftsländern wichtig sind. Ein Rückgang dieser Überweisungen könnte größere Migrationsströme zur Folge haben, was in Anbetracht der gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Lage weltweit ein ernsthaftes Problem darstellen könnte. Die Diskussion um die Bezahlkarte für Geflüchtete bleibt daher von zentraler Bedeutung für die Integration und die soziale Stabilität in Deutschland.
Die politische Landschaft in Deutschland bleibt angespannt, da weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Bezahlkarte und zur Gewährleistung der Integration von Geflüchteten diskutiert werden. Die Frage, ob die Bezahlkarte tatsächlich eine Hilfestellung darstellt oder ob sie eher Integrationshemmnisse schafft, wird die Zukunft der politischen Debatten in den kommenden Monaten stark prägen.