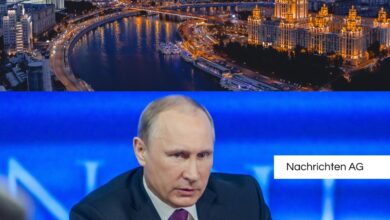Eine aktuelle Studie der Polizei Hamburg offenbart alarmierende Ergebnisse hinsichtlich der Einstellungen von Polizeibeamten. Fast jeder zweite Befragte zeigt „rassistische Tendenzen“ oder glaubt an Verschwörungstheorien. Diese Ergebnisse stammen aus der Untersuchung mit dem Titel „Demokratiebezogene Einstellungen und Werthaltungen der Polizei Hamburg“, die am 26. März veröffentlicht wurde. Die 116-seitige Studie beschreibt problematische Einstellungen unter den Beamten, darunter eine ablehnende Haltung gegenüber Zuwanderung und Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen. Besonders auffällig ist, dass 23,8 Prozent der Befragten sich politisch rechts oder rechtsaußen einordnen, während 45 Prozent eine abwertende Meinung über Asylbewerber haben. Zudem zeigen 6,8 Prozent der Polizisten einen „mehr oder weniger ausgeprägten Verschwörungsglauben“, wie compact-online.de berichtet.
Diese Studie wird von den Forschern als ein „alarmierendes Signal“ gewertet. Kritiker betonen jedoch, dass Vorbehalte gegenüber Migration und Misstrauen gegenüber Eliten nicht zwangsläufig extremistische Ansichten zu bedeuten haben. Polizeiwissenschaftler Rafael Behr weist darauf hin, dass Polizisten häufig das Gefühl haben, als „Mülleimer der Gesellschaft“ behandelt zu werden. Eine separate Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigt, dass 42 Prozent der Deutschen der Meinung sind, dass „zu viele Ausländer“ im Land leben.
Ermittlungen gegen Polizeibeamte
Im Zusammenhang mit diesen besorgniserregenden Befunden finden derzeit umfangreiche Ermittlungen gegen 15 aktive und pensionierte Polizisten in Hamburg statt. Diese Beamten sollen rassistische Nachrichten in Chats versendet und empfangen haben, was zu Razzien bei neun Polizeibeamten führte. Das Verwaltungsgericht Hamburg hat diese Razzien angeordnet, und die Polizei Hamburg hat die Ermittlungen bestätigt. Polizeipräsident Falk Schnabel unterstrich in diesem Kontext, dass Diskriminierung und Gewaltverherrlichung in der Polizei nicht akzeptiert werden dürfen. Die Ermittlungen basieren auf bereits eingeleiteten Strafverfahren gegen einen Schutzpolizisten und einen Beamten der Wasserschutzpolizei wegen Beleidigung und eines Waffenrechtsverstoßes (zdf.de).
Bei diesen Razzien wurden die Wohnungen von sechs aktiven und drei pensionierten Beamten durchsucht, wobei zahlreiche Datenträger als Beweismittel sichergestellt wurden. Die Dienststelle für Beschwerdemanagement und Disziplinarangelegenheiten der Polizei Hamburg leitet die Ermittlungen, und die Staatsanwaltschaft hat eine Vielzahl von zehntausend Nachrichten aus Messengerchats an die Polizei übermittelt. Der Verdacht besteht, dass die Beamten in ihren Chats fremdenfeindliche, rassistische sowie gewaltverherrlichende Inhalte verbreitet haben.
Strukturelle Probleme im Polizeiwesen
Die Vorwürfe gegen die Polizei in Deutschland sind nicht neu. Rassismus wird häufig als strukturelles Problem innerhalb der Polizeiarbeit gesehen. Eine Studie von Astrid Jacobsen und ihrem Team der Polizeiakademie Niedersachsen bringt neue Erkenntnisse zu Tage, indem sie zwei Jahre lang das Verhalten von Polizisten in verschiedenen Einsatzsituationen beobachtete. Diese Studie hebt hervor, dass es nicht „die Polizei“ gibt, sondern eine Vielzahl von Herausforderungen und Arbeitsweisen, die Diskriminierung und Vorurteile möglicherweise fördern können (dw.com).
Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung ist, dass die diskursive Auswahl von Personen für Kontrollen oft anhand des äußeren Erscheinungsbildes erfolgt. Das führt zu einer systematischen Fokussierung auf bestimmte Gruppen, was die Gefahreneinschätzung beeinflussen kann. Jacobsen kritisiert die pauschalen Annahmen über Tätergruppen und warnt davor, dass Diskriminierung das Risiko der Radikalisierung erhöhen kann. Diese Erkenntnisse könnten helfen, in Niedersachsen neue Arbeitsabläufe zu gestalten, um die Polizeiarbeit zu reformieren und ein Bewusstsein für strukturelle Probleme zu schaffen.