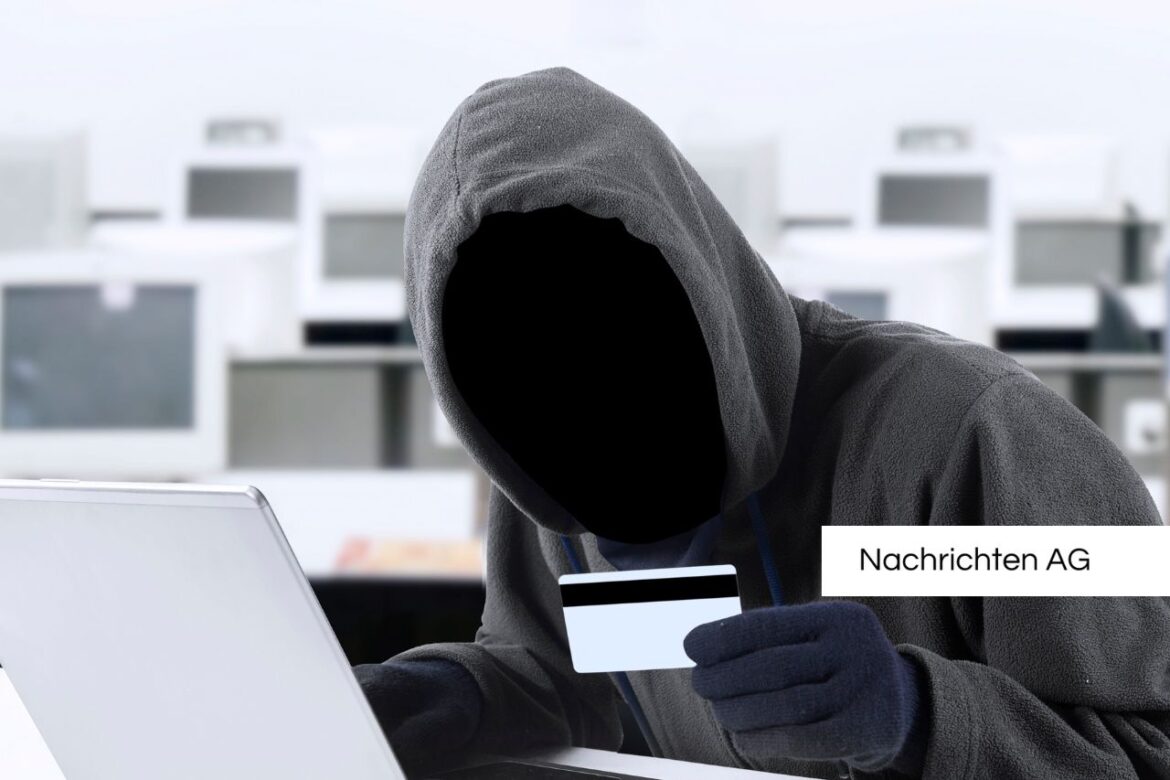
Die Debatte um mögliche Änderungen der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist in vollem Gange. Angestoßen wurde diese Diskussion von Allianz-Chef Oliver Bäte, der einen „Karenztag“ fordert. Dies bedeutet, dass Arbeitnehmer am ersten Krankheitstag keine Lohnfortzahlung erhalten würden, was in mehreren europäischen Ländern bereits praktiziert wird. Der Vorschlag kommt in einem Kontext, in dem die durchschnittlichen Krankheitszeiten in Deutschland eine besorgniserregende Höhe erreicht haben.
Im Jahr 2023 betrug die durchschnittliche Krankheitsdauer deutscher Arbeitnehmer 15,1 Arbeitstage. Laut der DAK Gesundheitsberichte haben die Versicherten im Schnitt sogar 20 Fehltage pro Jahr. Diese Zahlen sind alarmierend, insbesondere wenn man bedenkt, dass Schweden, ein Hauptbeispiel für eine erfolgreiche Lohnfortzahlungsregelung, im Durchschnitt nur acht Krankheitstage pro Jahr verzeichnet. Die Gründe für die hohen Ausfallzeiten sind vielfältig: von der erhöhten Meldequote durch digitale Übermittlung bis hin zu einem Anstieg von Erkältungen und Nachwirkungen der Corona-Pandemie.
Politische Reaktionen und Vorschläge
Die politische Reaktion auf den Vorschlag von Bäte ist jedoch gespalten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) äußerte sich kritisch und warnte vor möglichen Lohneinbußen sowie Gesundheitsrisiken. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lehnt den Karenztag entschieden ab, er betont, dass Deutsche keine „Drückeberger“ seien. Dies verdeutlicht die Abneigung vieler Politiker gegenüber einer solchen Maßnahme, die als ungerecht und potenziell gesundheitsschädlich angesehen wird.
Eine breite Front gegen den Karenztag bildet sich auch in der Gewerkschaftslandschaft. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnte vor der Ansteckungsgefahr, die durch „Präsentismus“, also das Arbeiten trotz Krankheit, entsteht. Kritiker warnen, dass kranke Arbeitnehmer aus Angst vor Lohnausfällen zur Arbeit erscheinen könnten, was ihrer Gesundheit abträglich wäre.
Finanzielle Aspekte und Alternativen
Die finanziellen Implikationen einer Lohnfortzahlungsreform sind ebenfalls ein zentrales Thema. Bäte argues, dass die Einführung eines Karenztags nicht nur die Arbeitgeber entlasten könne, sondern auch Einsparungen von bis zu 40 Milliarden Euro jährlich ermöglichen würde. Aktuell zahlen Arbeitgeber in Deutschland jährlich 77 Milliarden Euro für Gehälter von krankgeschriebenen Mitarbeitern, zuzüglich 19 Milliarden Euro von Krankenkassen. Die Argumentation für einen Karenztag basiert auf der Annahme, dass weniger Fehlzeiten die finanzielle Belastung der Unternehmen verringern könnten.
Es gibt jedoch auch Vorschläge, die Anreize statt Sanktionen setzen. Beispielsweise schlägt die FDP steuerfreie Prämien für Monate ohne Krankmeldung vor. Dies könnte ein Weg sein, trockenere Zeiten zu fördern, ohne dabei das finanzielle Risiko für Arbeitnehmer zu erhöhen.
Vergleich mit anderen EU-Ländern
Die Regelungen zur Lohnfortzahlung variieren stark innerhalb der EU. In Luxemburg erhalten Arbeitnehmer für die ersten 77 Krankentage 100 Prozent ihres Gehalts, während in Frankreich normalerweise 50 Prozent des Referenzlohns gezahlt werden. Im Vereinigten Königreich hingegen gibt es ab dem vierten Krankheitstag eine wöchentliche Zahlung von 123,91 Euro, die maximal 28 Wochen gezahlt wird.
In Deutschland genießen Arbeitnehmer bis zu sechs Wochen volles Gehalt und anschließend 70 Prozent ihres regulären Einkommens für bis zu 78 Wochen innerhalb von drei Jahren. Diese Regelung steht vor dem Hintergrund eines hohen Krankenstandes und den Bedenken der Arbeitgeber, die Argumente gegen den Karenztag als unzureichend empfinden, angesichts der steigenden Krankenstände.
Insgesamt bleibt die Einführung eines Karenztages in Deutschland eher unwahrscheinlich. Die politischen und sozialen Widerstände sind stark, und die potenziellen Risiken für die Gesundheit von Arbeitnehmern scheinen die möglichen finanziellen Vorteile zu überwiegen. Diese Diskussion bleibt jedoch eine zentrale Herausforderung für die kommenden Monate, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Bundestagswahlen im Februar 2025.



