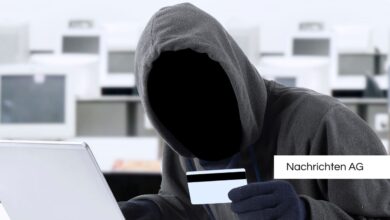In Sachsen wird die Jugendkriminalität momentan intensiv diskutiert. Geert Mackenroth, der Landeschef des „Weißen Rings“, kritisiert die starre Altersgrenze für die Strafverfolgung von Kindern. Diese Regelung führt dazu, dass Kinder unter 14 Jahren einen sogenannten „Persilschein“ erhalten, was bedeutet, dass sie strafrechtlich nicht verfolgt werden können. Mackenroth fordert eine Überprüfung dieser undifferenzierten Gesetzeslage. Ihm zufolge spiegelt das Alter nicht immer das psychologische Reife- oder Verantwortungsniveau der Täter wider und es ist daher notwendig, die Täterpersönlichkeit differenzierter zu betrachten.
Mackenroth betont, dass die Justiz engagierter auf Vorfälle reagieren sollte, da in der Vergangenheit oft zu wenig geschehen sei. Diese Rückmeldung kommt vor dem Hintergrund von aktuellen Diskussionen über die Jugendkriminalität und das Jugendstrafrecht, das in Deutschland spezifische Regelungen und Schutzvorschriften für Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren bietet.
Über die Rahmenbedingungen des Jugendstrafrechts
Das Jugendstrafrecht betrachtet, dass die persönliche Entwicklung von Jugendlichen noch im Gange ist. Jugendliche weisen in der Regel nicht die gleiche Reife und Verantwortungsbewusstsein wie Erwachsene auf. Die Philosophie des Jugendstrafrechts basiert auf dem Ziel, erneute Straffälligkeit zu verhindern, nicht primär darauf, zu bestrafen. Dies wird durch § 2 Abs. 1 JGG untermauert, der betont, dass bei Strafverfahren gegen Jugendliche sowohl das Alter als auch der Entwicklungsstand der Heranwachsenden berücksichtigt werden müssen. Der Geltungsbereich des Jugendstrafrechts umfasst Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren sowie Heranwachsende bis 21 Jahre unter bestimmten Voraussetzungen (BMJ).
Die Maßnahmen, die das Jugendgericht anordnen kann, unterscheiden sich erheblich von den Regelungen des allgemeinen Strafrechts. Jugendgerichte bieten vielfältigere Maßnahmen als das Erwachsenenstrafrecht, das auf Geld- und Freiheitsstrafen fokussiert. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem:
- Erziehungsmaßregeln wie soziale Trainingskurse und Anti-Aggressions-Trainings.
- Zuchtmittel wie Arbeits- und Wiedergutmachungsleistungen oder Jugendarrest bis zu vier Wochen.
- In schwerwiegenden Fällen kann eine Jugendstrafe, die zwischen sechs Monaten und zehn Jahren liegt, angeordnet werden.
Besonders ist auch die Rolle der Jugendgerichte hervorzuheben, die über speziell ausgebildete Richter und Staatsanwälte verfügen. Wichtige Merkmale des Jugendstrafverfahrens umfassen die Beteiligung der Jugendgerichtshilfe sowie erweiterte Verteidigungsrechte und nicht-öffentliche Verhandlungen.
Aktuelle Trends in der Jugendkriminalität
Die Jugendkriminalität wird in Deutschland als ein Phänomen wahrgenommen, das vorrangig männlich ist und es zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche häufig selbst Opfer von Gewalt werden. Statistiken zeigen, dass die Mehrheit der Jugendlichen, die straffällig werden, dies nur episodisch tut und ihr Verhalten mit dem Erwachsenwerden häufig einstellen. Es besteht ein deutlicher Rückgang der Jugendkriminalität in den letzten Jahren, auf ein Niveau, das vergleichbar ist mit den späten 1980er Jahren. Interessanterweise ist der Anteil der Jugendlichen, die bei erheblichen Delikten auffallen, relativ gering. So gaben beispielsweise in einer bundesweiten Schülerbefragung 43,7% der männlichen und 23,6% der weiblichen Schüler an, in den letzten 12 Monaten straffällig geworden zu sein (bpb).
Die häufigsten Delikte sind geringfügig und Gewaltverbrechen sind noch seltener. Die Analyse der Anzeigebereitschaft zeigt, dass diese je nach Deliktsart stark variiert. Für Körperverletzungsdelikte liegt diese beispielsweise bei nur 12,5% der Fälle. Ein interessantes Detail ist, dass Jugendliche häufiger als Täter von Innen, wie etwa in familiären Zusammenhängen, Gewalt betroffen sind, als dass sie selbst als Täter auftreten. Die Aufklärungsquote der registrierten Fälle liegt bei 58,7% und zeigt damit auch das Potenzial einer effektiven Strafverfolgung und Präventionsarbeit.
Die Diskussion um das Jugendstrafrecht ist also komplex und erfordert einen differenzierten Blick auf Täter, Opfer und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, um langfristige Lösungen für die Verringerung von Jugendkriminalität zu finden.