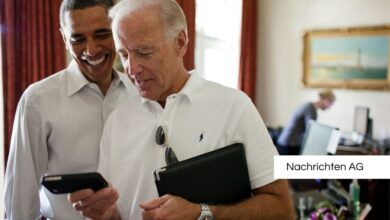Am 9. April 2025 hielt Prof.in Dr.in Raphaela Porsch ihre Antrittsvorlesung an der Universität Vechta. Unter dem Titel „Quo vadis Lehrer*innenbildung in Deutschland?“ stellte sie sich einer der zentralen Herausforderungen der Bildungslandschaft in Deutschland. Porsch, die als Professorin für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik an der Universität aktiv ist, befasste sich in ihrer Rede mit der Systematisierung der Modelle zur Lehrer*innenbildung in den verschiedenen Bundesländern und beleuchtete sowohl die Potenziale als auch die nicht-intendierten Folgen dieser Systeme.
Die Antrittsvorlesung ist an der Universität Vechta eine geschätzte Tradition, die den Beginn der akademischen Laufbahn neuer Professorinnen und Professoren markiert. Prof.in Dr.in Corinna Onnen hob in ihrer Einführung die Schlüsselrolle von Porsch in der Lehrer*innenbildung hervor. Die Relevanz ihrer Forschung wird auch durch die aktuelle Struktur der Lehrer*innenbildung in Deutschland unterstrichen, die durch ein dreiphasiges Modell geprägt ist: erstes Studium, anschließender schulpraktischer Vorbereitungsdienst und schließlich lebenslange Fort- und Weiterbildung.
Differenzen zwischen den Bundesländern
In der Diskussion um die Lehrer*innenbildung sind die Unterschiede zwischen den Bundesländern nicht zu übersehen. So liefern sieben Bundesländer Staatsexamen nach dem Studium, während elf Bundesländer Bachelor- und Masterstudiengänge anbieten. Zwei Bundesländer kombinieren beide Optionen. Zudem gibt es verschiedene Lehramtstypen, darunter die Primarstufe, Sekundarstufe I und II sowie Sonderpädagogik. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist das Stufenlehramt, das in sechs Bundesländern vorhanden ist und für die Ausbildung angehender Lehrkräfte für Sekundarstufen zuständig ist.
Porsch wies auch auf alternative Programme zur Lehrkräftequalifizierung hin, wie den Quereinstieg, der ein Fachstudium und ein Referendariat umfasst, sowie den Seiteneinstieg, der das Lehramtsstudium und das Referendariat überspringt. Diese Programme sind in ihrer Wirksamkeit heterogen und werfen Fragen bezüglich ihrer Evaluierung und der gezielten Förderung der Lehrkräfte auf. Porsch betont die wichtige Analyse der Potentiale und Herausforderungen, die mit diesen Lehramtsprogrammen verbunden sind, und warnt vor einer zunehmenden Heterogenität.
Die Herausforderungen der Lehrer*innenbildung
Ein zentrales Anliegen der Vorlesung waren die Herausforderungen, die mit der Mobilität zwischen den Bundesländern verbunden sind. Die aktuelle Problematik umfasst nicht nur den Fachlehrermangel, sondern auch das fachfremde Unterrichten in vielen Schulen. Vor diesem Hintergrund stellte Porsch eine Vielzahl von Vorschlägen zur Verbesserung vor. Darunter fallen die Einstellung der derzeitigen Seiteneinstiegsprogramme, eine Neugestaltung des Quereinstiegs über Fachmasterstudiengänge sowie die Implementierung von Evaluationen für alle Programme.
Besonders wichtig ist die Diskussion über eine gemeinsame Basiskultur in der Lehrer*innenbildung, die sowohl die grundlegende Art der Lehrer*innenbildung als auch das Verständnis des Berufs und die notwendige Kompetenzen der Lehrkräfte betrifft. Porsch plädierte für eine breite Diskussion über die bestehenden Modelle und deren Herausforderungen, um den aktuellen Anforderungen an die Lehrkräfte gerecht zu werden. Ihre Ausführungen zeigen, dass die Lehrer*innenbildung in Deutschland nicht nur eine Frage der strukturellen Anpassungen ist, sondern auch das Ziel verfolgt, die Qualität der Bildung nachhaltig zu sichern.
In der Vorlesung wurden grundlegende Fragen zur Lehrer*innenbildung aufgerufen: Welche Merkmale müssen für die unterschiedlichen Gruppen von Lehrkräften gelten? Ist ein Stufenlehramt notwendig oder wäre eine schultypenbezogene Ausbildung sinnvoller? Diese Fragen verdeutlichen, wie dringend es ist, die Diskussion um die Lehrer*innenbildung voranzutreiben und zu intensivieren.
Für weitere Informationen zur Lehrerbildung in Deutschland und deren Struktur, verweist das Fachportal Pädagogik auf umfassende Forschungsarbeiten und rechtliche Rahmenbedingungen, die für die Orientierung von entscheidender Bedeutung sind. So wird eine kritische Auseinandersetzung mit den aktuellen Modellen notwendig, um den Herausforderungen an die Bildungstätigkeiten zu begegnen.
Die Zukunft der Lehrer*innenbildung steht damit im Fokus und erfordert innovative Ansätze und eine enge Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen. Die Antrittsvorlesung von Prof.in Dr.in Raphaela Porsch verdeutlicht, dass die Thematik von zentraler gesellschaftlicher Bedeutung ist, und dass es an der Zeit ist, transformative Schritte zu unternehmen.
Für detaillierte Informationen zur Veranstaltung und den Vorlesungsinhalten, siehe die Berichterstattung von mynewsdesk und die umfassenden Analysen von Fachportal Pädagogik.