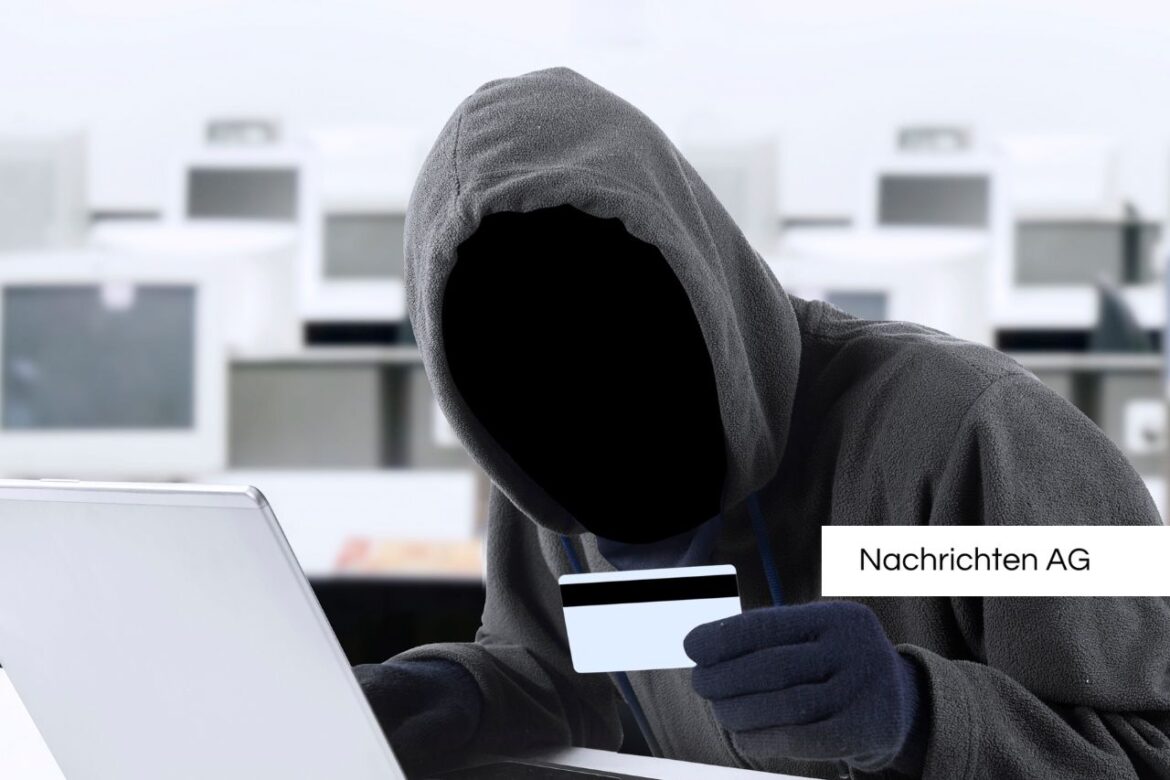
Im Jahr 2024 ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland auf 16 Prozent gesunken. Dies stellt einen Rückgang von zwei Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr dar und ist der erste Rückgang seit 2020, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Der Rückgang ist maßgeblich auf höhere Lohnsteigerungen für Frauen zurückzuführen, welche im Jahr 2024 stärker ausgefallen sind als die der Männer. Diese Entwicklungen sind besonders bemerkenswert, da sich die Lohnlücke seit 2006 nie so schnell innerhalb eines Jahres verringert hat.
Im Jahr 2006 betrug der Verdienstunterschied zwischen den Geschlechtern noch 23 Prozent. Im Jahr 2024 verdienten Männer durchschnittlich 26,34 Euro pro Stunde, was 4,10 Euro über dem Lohn von Frauen liegt. Knapp zwei Drittel der Lohnlücke können durch höhere Teilzeitquoten bei Frauen sowie durch geringere Gehälter in sogenannten frauentypischen Berufen erklärt werden. Trotz des Rückgangs bleibt der bereinigte Gender Pay Gap unverändert bei 1,52 Euro oder etwa 6 Prozent des Brutto-Stundenlohns.
Gender Pay Gap und seine Analyse
Der Gender Pay Gap, der die Differenz der Verdienste pro Stunde zwischen Frauen und Männern darstellt, ist ein zentraler Indikator für Verdienstungleichheit. Der unbereinigte Gender Pay Gap betrachtet die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste ohne Anpassungen. Die Analyse des bereinigten Gender Pay Gap berücksichtigt Faktoren wie Beruf, Branche, Beschäftigungsumfang, Qualifikation und Karrierelevel. Der bereinigte Gender Pay Gap veranschaulicht den Teil der Lohnlücke, der potenziell auf Verdienstdiskriminierung zurückzuführen ist.
Laut aktuellen Daten aus dem Jahr 2023 betrug der unbereinigte Gender Pay Gap 18 %, was bedeutet, dass Frauen pro Stunde 18 % weniger als ihre männlichen Kollegen verdienten. Etwa 64 % dieser Verdienstlücke sind durch verfügbare Merkmale erklärbar, vor allem aufgrund von schlechter bezahlten Berufen und Teilzeitarbeit, die häufig von Frauen geleistet wird. Der unerklärte Anteil des Verdienstunterschieds beträgt somit 36 % und bleibt bei einem bereinigten Gender Pay Gap von 6 %.
Ursachen und Einflussfaktoren
Erwerbsunterbrechungen, häufig bedingt durch familiäre Verpflichtungen wie Schwangerschaft oder Kindererziehung, wirken sich ebenfalls negativ auf die Löhne von Frauen aus. Diese Unterbrechungen sind ein Teil des Gesamtbildes, das die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen beeinflusst. Frauen arbeiteten 2023 im Durchschnitt 121 Stunden pro Monat, während Männer 148 Stunden arbeiteten, was zu einem Gender Hours Gap von 18 % führte und Frauen rund 32 % weniger Einkommen einbrachte.
Zusätzlich zu diesen Zahlen zeigt sich ein Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen, die von 69 % im Jahr 2014 auf 73 % im Jahr 2023 gewachsen ist. Im selben Zeitraum stieg die Erwerbsbeteiligung der Männer lediglich um knapp 3 Prozentpunkte. Diese Entwicklung zeigt, dass immer mehr Frauen, auch mit Kindern, aktiv am Arbeitsmarkt teilnehmen. Trotzdem sind Frauen häufig in Niedriglohnberufen überproportional vertreten.
Der Gender Employment Gap, der die Unterschiede in der Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen erfasst, lag 2022 bei 9 % und ist seit 2014 um 2 Prozentpunkte gesunken. Der Rückgang ist auf verschiedene Maßnahmen, wie das Teilzeit- und Befristungsgesetz, zurückzuführen, das mehr Rechtssicherheit für Teilzeitkräfte bietet.
Um die Einkommensunterschiede zu verringern, werden weiterhin verschiedene Initiativen und Programme gefordert, die Frauen in Berufen fördern, die mit Familie und Karriere besser vereinbar sind. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Gender Pay Gap bis 2020 auf 10 % zu reduzieren, was allerdings nicht erreicht wurde.
Insgesamt ist der Trend der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern zwar rückläufig, jedoch existieren nach wie vor bedeutende Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Der Weg zu einer vollumfänglichen Gleichstellung ist noch lang und erfordert weiterhin Engagement und zielgerichtete Maßnahmen.



