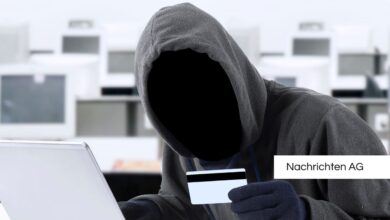Am 1. Februar 2025 fand in Köln eine Premiere der besonderen Art statt. Erstmals trafen sich in der Rundfunk-Sendung „frank & frei“ ein katholischer Bischof und eine evangelische Bischöfin, um über die zentrale Frage zu diskutieren: Brauchen wir einen Papst? Moderiert von Joachim Frank, dem Chefkorrespondenten von DuMont, nahm der Politologe Otto Kallscheuer, Autor von „Papst und Zeit“, an der Diskussion teil. Kallscheuer stellte klar, dass die katholische Kirche und der Papst essenziell für den Zusammenhalt der Glaubensgemeinschaft seien, besonders in Zeiten der Globalisierung. Dabei war die Rolle des Papstes als Sprecher der Christenheit umstritten; Petra Bahr äußerte Bedenken hinsichtlich seiner Bedeutung in der heutigen Welt.
Bischof Overbeck sieht den Papst zwar als eine Symbolgestalt für das Christentum, er betont jedoch die innere Autonomie der katholischen Kirche. In diesem Kontext kam die Diskussion auch auf einen Brandbrief der Kirchen zu sprechen. Dieser Brief, der an die CDU/CSU und die AfD im Bundestag gerichtet war, stieß bei den beiden Kirchenvertretern auf Kritik. Overbeck bezeichnete die Zusammenarbeit mit der AfD als „schrecklich“ und Bahr nannte dies den „größten Tabubruch in der parlamentarischen Geschichte Deutschlands“. Beide distanzierten sich von der gemeinsamen Erklärung. Overbeck riet sogar dazu, vor Wahlen keine politischen Kommentare abzugeben.
Herausforderungen der Kirchen in der Politik
Ein weiteres zentrales Thema der Diskussion war die Balance zwischen der Menschenwürde und den Sorgen der Bürger, vor allem in Bezug auf Asyl und Migration. Diese Thematik gewinnt vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Landschaft, insbesondere in der Asylpolitik, zunehmend an Bedeutung. Pro Asyl hat die CSU und die CDU der Radikalisierung in der Asylpolitik vorgeworfen, da Grundrechte verletzt würden, um Wähler rechter Parteien zu gewinnen. Wiebke Judith, Rechtsexpertin bei Pro Asyl, äußerte ihre Besorgnis über die Erosion von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten in Deutschland.
Die CSU plant einen „Sicherheitsplan“ für den Bundestagswahlkampf, der allgemeine Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den deutschen Grenzen fordert. Judith merkt an, dass dies gegen Völker- und Europarecht verstoßen würde. Zudem sollen ausländische Straftäter nach Verbüßung ihrer Strafe unbefristet in Abschiebehaft genommen werden, was als verfassungswidrig gilt. Auch die CDU fordert strengere Maßnahmen gegen straffällige Asylbewerber, inklusive schnellerer Abschiebungen. Friedrich Merz, Kanzlerkandidat der Unionsparteien, geht sogar so weit, Erleichterungen bei Zurückweisungen und Ausweisungen von Migranten zu fordern.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Migration
Um sich mit der Migrationssituation auseinanderzusetzen, hatten die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) bereits am 21. Oktober 2021 ein ökumenisches Grundlagenwort veröffentlicht. Unter dem Titel „Migration menschenwürdig gestalten“ wurde ein Dokument erarbeitet, das Orientierung für die Gestaltung von Migration unter unvollkommenen Bedingungen bieten soll. Der Bischof Dr. Franz-Josef Bode betonte hierbei die Bedeutung des Textes für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Ablehnung von Menschenfeindlichkeit. Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm wies auf die Missachtung der Würde und Rechte von Geflüchteten hin und forderte eine europäische Flüchtlingspolitik, die sich an Menschenrechten orientiert.
In Deutschland leben rund 975.000 Syrer, die vor allem nach dem Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2015 flüchteten. Von diesen haben über 300.000 einen subsidiären Schutztitel erhalten. Robert Habeck von den Grünen hob hervor, dass Arbeit das zentrale Kriterium für die Perspektive geflüchteter Syrer in Deutschland sein muss. Der Umgang mit syrischen Flüchtlingen steht somit im Vordergrund der politischen Debatte, insbesondere nach dem Sturz des Assad-Regimes.
In dieser komplexen Gemengelage um Migration, Grundrechte und interreligiösen Dialog bleibt die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Papstes und der Rolle des Amtsinhabers nicht unbeantwortet. Kallscheuer kritisierte Papst Franziskus für seine Haltung zur Ukraine sowie den Umgang mit der orthodoxen Kirche, was die Diskussion um die Ideologie des russischen Imperialismus weiter anheizte. Die Einigkeit unter den Diskutanten über die Notwendigkeit, diese Ideologie anzuprangern, könnte ein Schritt in Richtung einer gerechteren und ethischeren Betrachtung der Migration und ihrer Auswirkungen auf die Gesellschaft darstellen.
Insgesamt zeigt die Diskussion, in der sowohl kirchliche als auch politische Perspektiven beleuchtet wurden, dass die Frage nach der Notwendigkeit des Papstes und der Umgang mit Migration eng miteinander verknüpft sind und eine Herausforderung der modernen Gesellschaft darstellen.