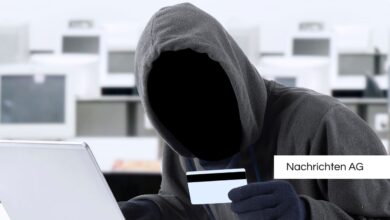Jens Spahn, ein prominent gewordener Berufspolitiker der CDU, hat während seiner Amtszeit als Gesundheitsminister im Kabinett Merkel III von 2013 bis 2017 eine Reihe von Entscheidungen getroffen, die auch Jahre nach der Corona-Pandemie immer noch heiß diskutiert werden. Geboren in Ahaus, Nordrhein-Westfalen, trat Spahn bereits mit 15 Jahren der Jungen Union bei und wurde 2002 im Alter von 22 Jahren in den Bundestag gewählt. Mit seiner Ernennung zum Gesundheitsminister im Alter von 38 Jahren wurde er zur zentralen Figur in der Corona-Politik Deutschlands.
Seine Entscheidungen während der Pandemie stießen vielerorts auf scharfe Kritik. Besonders im Fokus stehen seine Masken-Deals, bei denen er Verträge über mehrere Milliarden Euro zur Beschaffung von Schutzmasken abschloss. Laut compact-online.de wurden teils unerfahrene Firmen mit der Lieferung beauftragt, was zu massiven finanziellen Verlusten führte und zur Entsorgung von Millionen unbrauchbaren Masken. Dies geschah trotz der hohen Summen, die bereits ausgegeben wurden. Der Rechnungshof kritisierte zudem die mangelhafte Dokumentation und Kontrolle dieser Beschaffungen.
Kritik an der Beschaffung von Masken
Eine detaillierte Analyse des Masken-Beschaffungsverfahrens ergibt, dass der Bund insgesamt 5,7 Milliarden Corona-Masken für 5,9 Milliarden Euro erwarb. Doch nur zwei Milliarden Masken erreichten die Bevölkerung, während der Rest größtenteils nicht gebraucht und vernichtet wurde, wie der Deutschlandfunk berichtet. Das Bundesgesundheitsministerium hatte damals ein Open-House-Verfahren entwickelt, wodurch über 700 Unternehmen angezogen wurden. Die kurzfristigen Lieferfristen und vorgebrachten Qualitätsmängel führten jedoch dazu, dass viele Masken letztendlich nicht abgenommen wurden.
Zudem kam es zu rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Ministerium und zahlreichen Lieferanten, deren Rechnungen nicht beglichen wurden. Diese Problematik führte dazu, dass das Oberlandesgericht Köln den Lieferanten Recht gab, wobei eine Revision nicht zugelassen wurde. Die Summen, die Spahn somit zu verantworten hat, könnten durch bevorstehende Kosten und Verzugszinsen auf bis zu 3,5 Milliarden Euro anwachsen. Solche finanziellen Dimensionen werfen erneut Fragen zur politischen Verantwortung auf.
Gesellschaftliche und politische Folgen
Spahn geriet auch wegen seiner 2G-Regel in die öffentliche Kritik, die Ungeimpften den Zugang zu öffentlichen Orten verwehrte. Diese Regelung, gekoppelt mit Äußerungen wie „Pandemie der Ungeimpften“, führte zur Spaltung der Gesellschaft und zu Vorwürfen der Grundrechtsverletzung. Kritiker werfen ihm vor, eine Kultur der Denunziation gefördert zu haben und wissenschaftliche Unsicherheiten über die Übertragbarkeit des Virus durch Geimpfte ignoriert zu haben. Viele sehen in ihm ein Beispiel für einen entfremdeten Politikbetrieb.
Die Aufarbeitung von Spahns Entscheidungen und der gesamten Corona-Politik dürfte notwendig sein, um Lehren für künftige Krisen zu ziehen, so fordert es auch verfassungsblog.de. Diese Diskussion sollte transparent und fair geführt werden, indem eine klare Trennung von rechtlicher, moralischer und politischer Verantwortung vorgenommen wird. Die politische Verantwortung wird von den ökonomischen und sozialen Folgen der Coronapolitik geprägt, die für die kommenden Jahre entscheidend sein werden.
Spahn hat sich zuletzt auch zu den Herausforderungen der politischen Diskussion geäußert und moderat betont, dass man der AfD auch ohne Ausgrenzung begegnen könne. Dennoch bleibt seine Rolle während der Corona-Pandemie aus Sicht vieler Kritiker umstritten, sodass eine umfassende Analyse, die möglicherweise zur Einrichtung parlamentarischer Untersuchungsausschüsse führt, unabdingbar scheint.
In der Bilanz wird Jens Spahn als Symbolbild für die Schwierigkeiten und die psychologischen Effekte der Pandemie sowie als ein zentraler Akteur im komplexen Beziehungsgeflecht von Entscheidungsgewalt, politischer Verantwortung und gesellschaftlicher Verantwortung wahrgenommen.