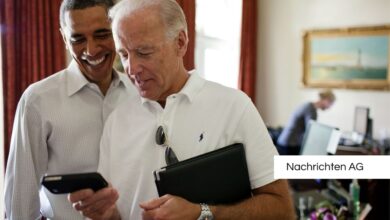Julia Klöckner, die Bundestagspräsidentin und CDU-Politikerin, hat in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ das politische Engagement der Kirchen in Deutschland scharf kritisiert. Sie bezeichnete das Wort der Kirchen als „austauschbar“ und machte deutlich, dass diese zunehmend wie Nichtregierungsorganisationen (NGOs) agieren. Klöckner wünscht sich von den Glaubensgemeinschaften mehr Sinnstiftung und klare Stellungnahmen zu grundlegenden ethischen Fragen, insbesondere zu Themen des Lebensanfangs und -endes. Ihre Aussagen haben in der Öffentlichkeit für viel Diskussion gesorgt und wurden teils als provokant wahrgenommen.
Besonderes Augenmerk legte Klöckner auf die Einmischung der Kirchen in aktuelle politische Debatten, etwa zum Thema Tempolimit. Sie warf den Kirchen vor, sich nicht genug um ihre ureigenen seelsorgerischen Aufgaben gekümmert zu haben, ein Punkt, den sie tabellarisch an der Corona-Pandemie festmachte. Kritiker entgegneten jedoch, dass die Kirchen während der Krise aktiv um die Aufrechterhaltung von Gottesdiensten und Seelsorge bemüht waren.
Reaktionen auf Klöckners Aussagen
Die Verwendung des Begriffs „NGO“ durch Klöckner wird in konservativen Kreisen als mehrdeutig empfunden. Viele interpretieren ihn als eine negative Konnotation, die darauf abzielt, die Kirchen als zu links darzustellen, was die Diskussion weiter polarisiert. Die Kirchen stehen traditionell für Werthaltungen, die dem Menschenleben und der Menschenwürde einen hohen Stellenwert einräumen, und solche Äußerungen werden als Kampfbegriff angesehen.
In diesem Kontext reichen die kirchlichen Argumente weit über das rein Religiöse hinaus. Laut einer Studie von Prof. Dr. Judith Könemann, die auf Medienberichten über einen Zeitraum von 30 Jahren basierte, nutzen Kirchen in Deutschland bei etwa 60 Prozent ihrer öffentlichen Äußerungen weltliche Begründungen. Religiöse Argumente spielen demnach eine untergeordnete Rolle und werden nur selten in Diskussionen thematisiert. In vielen Fällen fungieren die Kirchen als Anwälte der Migranten oder setzen sich für soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde ein. Dies zeigt, dass Kirchen als etablierte Akteure der politischen Landschaft anerkannt werden, die auch Einfluss auf Gesetzesvorhaben haben.
Politische Einflussnahme der Kirchen
In der politischen Debatte um Fragen wie Abtreibung oder Zuwanderung sind die Beiträge der Kirchen von erheblichem Gewicht. Schulterschlüsse mit zivilgesellschaftlichen Strukturen und Anklänge an aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen prägen die kirchliche Interessenvertretung. Klöckners Aussage über die angebliche Umwandlung der Kirchen in NGOs mündet in eine grundlegendere Diskussion über die Rolle von Religionsgemeinschaften in der modernen Gesellschaft, die bereits seit Jahrzehnten in der Forschung thematisiert wird, insbesondere im Rahmen des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ an der Universität Münster.
Auf einer Tagung in Köln wurden auch neue Ansätze zur Untersuchung des politischen Einflusses der Kirchen präsentiert. Studien zeigen, dass die Kirchen durch ihre öffentliche Präsenz und ihre Argumentationsstrategien nicht nur bei bestimmten Themen wie Fremdenfeindlichkeit oder islamischem Religionsunterricht Einfluss nehmen konnten, sondern auch in der allgemeinen politischen Willensbildung eine Rolle spielen.
Klöckners Äußerungen werfen somit die Frage auf, wie Kirchen ihre Rolle im politischen Diskurs weiter interpretieren und welche Botschaften sie in die Gesellschaft tragen wollen. In einer Zeit, in der polarisierende Begriffe und Debatten zunehmen, bleibt abzuwarten, ob Klöckners Kritik an den Kirchen auch zu einem Umdenken bei diesen führen wird.