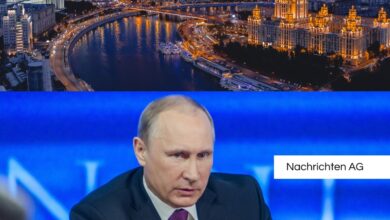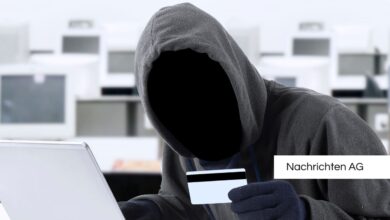Eine aktuelle Studie des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Münster befasst sich mit der sozialen Teilhabe von Jugendlichen in stationären Jugendhilfeeinrichtungen während der Coronapandemie. Diese Untersuchung ist besonders relevant, da der Fokus auf einer Gruppe liegt, die im Vergleich zu ihren Altersgenossen, die in Familien leben, mit härteren Einschränkungen konfrontiert wurde. Unter der Leitung von Prof. Dr. Claudia Equit und Elisabeth Thomas, und gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, bietet die Studie wertvolle Einblicke in die Lebensrealitäten von 40 betroffenen Jugendlichen im Alter von 14 bis 22 Jahren aus 27 verschiedenen Einrichtungen.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Gleichaltrige eine entscheidende Unterstützung beim Umgang mit den pandemiebedingten Restriktionen darstellten. Die Jugendlichen entwickelten unterschiedliche Strategien, um mit der Isolation umzugehen. Dazu zählten digitaler Kontakt, aber auch negative Bewältigungsmechanismen wie Drogenkonsum und Schulvermeidung. Die Sicherheitsauflagen führten häufig zu Kontaktbeschränkungen zu den Herkunftsfamilien, insbesondere im betreuten Einzelwohnen, wo einige Jugendliche über längere Zeiträume isoliert waren.
Herausforderungen und Lösungsansätze
Trotz der schwierigen Umstände zeigte sich bei den Jugendlichen eine bemerkenswerte Bereitschaft, kreativ mit ihrer Isolation umzugehen. Oftmals waren die Lernbedingungen erschwert, da notwendige technische Ausstattungen wie Laptops und Internetverbindungen fehlten und die Hilfestellung beim digitalen Lernen unzureichend war. Jugendliche, die in Pflegefamilien untergebracht sind, berichteten über bessere Bedingungen, jedoch auch von Konflikten und Gewalt in diesen Familien.
Die Untersuchung schließt eine zentrale Forschungslücke und trägt zur Entwicklung von Qualitätskriterien zur Förderung sozialer Teilhabe bei. Das angegebenen Projekt, als Teil des Forschungsprojekts Soziale Teilhabe von Jugendlichen in stationären Hilfen, zielt darauf ab, die Auswirkungen der Coronakrise auf Teilhabe- und Entwicklungsbedingungen sowie Bildungsbenachteiligungen zu rekonstruieren. Dabei werden die Perspektiven von Jugendlichen und Fachkräften der Jugendhilfe in den Mittelpunkt gestellt.
Die Forschung im Detail
Ein besonderer Fokus liegt auf vier Sozialisationsfeldern: Schule, Herkunftsfamilie, Gleichaltrige und die Systeme des Wohlfahrtsstaates, zu denen die Jugendhilfe und das Gesundheitssystem zählen. Wie in den Ergebnissen des Projektes JuPa hervortritt, sollen die Erkenntnisse in Form einer Handreichung für Fachkräfte aufbereitet werden, die konkrete Qualitätskriterien und Fördermöglichkeiten enthält. Die Datenerhebung erfolgt durch Leitfadeninterviews mit Jugendlichen sowie standardisierte Fragebogenbefragungen mit Fachkräften der Jugendhilfe, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
Die Forschungsziele umfassen auch die Entwicklung innovativer, praxistauglicher Konzepte, die mittels partizipativer Verfahren mit betroffenen Gruppen erarbeitet werden. Das Projekt soll bis zum 31. Januar 2026 fortgeführt werden und hat sich die Verbesserung der Lebenslagen von Jugendlichen in stationären Jugendhilfeeinrichtungen zur Aufgabe gemacht.