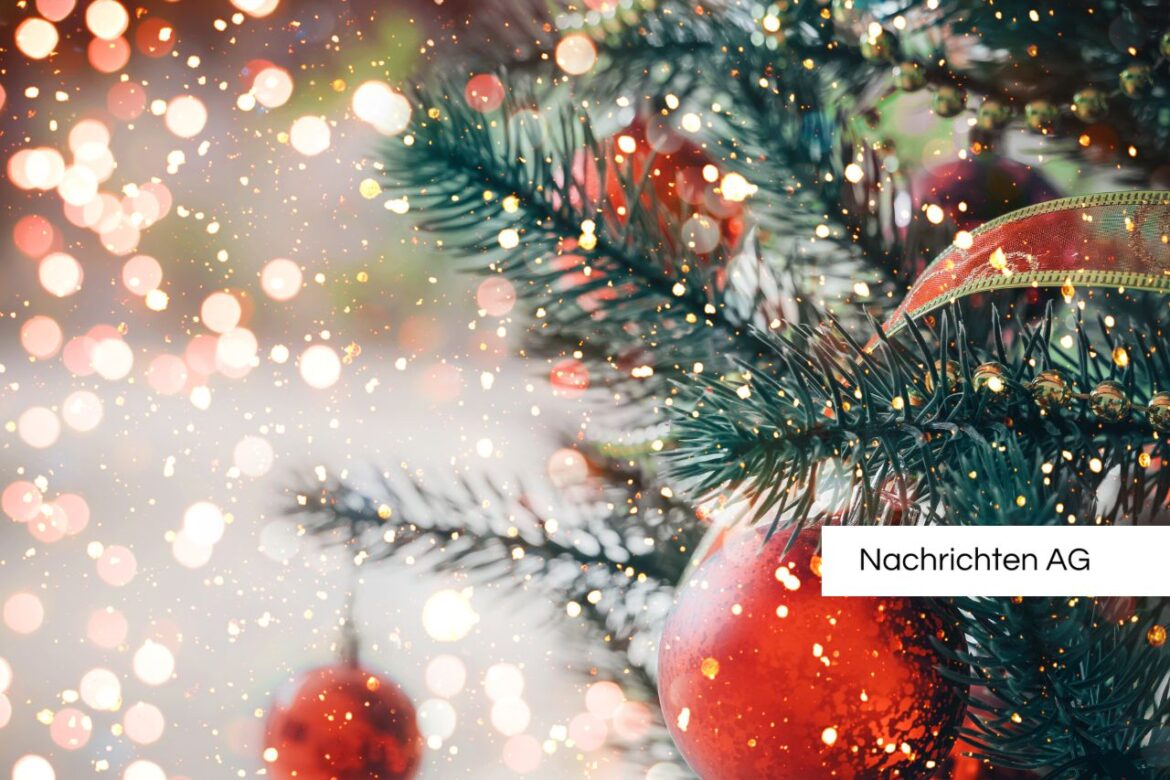
Am 20. Dezember 2024 ereignete sich ein tragischer Vorfall auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg, als Taleb Jawad Al Abdulmohsen, ein 50-jähriger in Deutschland anerkannter Asylbewerber aus Saudi-Arabien, mit seinem Auto in eine Menschenmenge fuhr. Dieser Anschlag forderte sechs Menschenleben und verletzte eine dreistellige Zahl von Personen, was eine Schockwelle durch die Gesellschaft auslöste. Abdulmohsen war zuletzt als Facharzt für Psychiatrie in Bernburg tätig und wurde zur Vermeidung eines unmittelbaren Kontakts mit den Angehörigen der Opfer in die Justizvollzugsanstalt Dresden verlegt. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe entschied sich gegen die Übernahme der Ermittlungen, da keine klare politische Motivation erkennbar war, wie Remszeitung berichtet.
Vor seinem gewalttätigen Ausbruch hatte Abdulmohsen in einem Video erklärt, ein deutscher „Agent“ habe ihm einen Memory-Stick gestohlen, und machte das deutsche Volk dafür verantwortlich. Dies wirft Fragen über mögliche Wahnvorstellungen und eine gravierende psychische Erkrankung auf, die bei ihm festgestellt wurde, während er bei den Behörden als potenziell verdächtig galt. Bereits 2014 war er wegen einer Drohung verurteilt worden, in der er auf den Anschlag in Boston hinwies und drohte: „Sowas passiert dann hier auch“, wie Tagesschau berichtet.
Psychische Gesundheit und Extremismus
Der Anschlag in Magdeburg und ein ähnlicher Vorfall in Aschaffenburg, bei dem ein 28-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan einen zweijährigen Jungen tötete, haben die Diskussion über die Verbindung zwischen psychischen Erkrankungen und extremistischen Taten neu entfacht. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Tat in Aschaffenburg als „unfassbare Terrortat“. Dies und die Tatsache, dass der Täter vorher bei Behörden und Psychiatrie auffällig geworden war, wirft grundlegende Fragen über Sicherheitsmaßnahmen und die Risiken psychischer Erkrankungen auf, wie sie die Bundeszentrale für politische Bildung thematisiert hat.
Empirische Studien zeigen, dass ein hoher Prozentsatz von Inhaftierten an psychischen Störungen leidet. Unter extremistisch motivierten Straftätern weisen viele eine signifikante psychische Belastung auf. Es wurde festgestellt, dass über ein Drittel dieser Personen psychische Störungen haben könnten, was zeigt, dass psychische Erkrankungen eine entscheidende Rolle bei der Radikalisierung spielen können.
Öffentliche Reaktionen und politische Konsequenzen
Die Taten und die darauf folgenden Diskussionen haben politisch für Druck auf die Behörden gesorgt. In Magdeburg plant die AfD eine Kundgebung, während parallel dazu eine Menschenkette von der Initiative „Gib Hass keine Chance“ gebildet wird. Diese Ereignisse zeigen, wie brisant das Thema ist und wie sehr es die Gesellschaft spaltet. Der Landkreistag hat außerdem darauf hingewiesen, dass ein absoluter Schutz auf Weihnachtsmärkten unmöglich sei, was die Verwundbarkeit solcher Veranstaltungen verdeutlicht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tragödien in Magdeburg und Aschaffenburg nicht nur Fragen zur Sicherheit aufwerfen, sondern auch zur Verantwortung von Behörden in der Behandlung von psychisch auffälligen Personen. Die Überlegungen zur möglichen Verbindung von psychischer Gesundheit und extremistischen Tendenzen sollten ernsthaft betrachtet werden, um zukünftige Vorfälle zu vermeiden.



