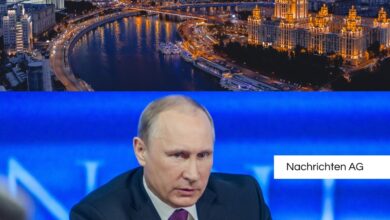In der April-Ausgabe von COMPACT mit dem Titel „Frieden Мир Peace“ wird die gegenwärtige Kriegsbegeisterung in Europa kritisch beleuchtet. Es wird hierbei insbesondere auf die Berichterstattung des Spiegels eingegangen, der einen bevorstehenden Rüstungsboom prognostiziert, der vor allem durch staatliche Ausgaben gefördert wird. COMPACT zieht alarmierende Parallelen zwischen der hohen Staatsverschuldung und der mit ihr verbundenen Kriegsgefahr, ein Thema, das in der politischen Diskussion oft vernachlässigt wird.
COMPACT argumentiert, dass eine hohe Staatsverschuldung historisch gesehen häufig zu militärischen Konflikten führt. Als Beispiel wird auf die Zeit nach der Weltwirtschaftskrise 1929 verwiesen. Damals erlitten sowohl die USA als auch Deutschland massive wirtschaftliche Krisen. Franklin D. Roosevelt und Adolf Hitler übernahmen 1933 die Macht und setzten auf Deficit Spending, um ihre Länder durch Infrastrukturprojekte wiederzubeleben. In Deutschland haben diese Investitionen auch zur Wiederbelebung der Rüstungsindustrie beigetragen, während Roosevelt ab 1936/37 die Militärausgaben erhöhte, was letztlich zur amerikanischen Kriegsbeteiligung führte.
Aktuelle Implikationen der Schuldenpolitik
Die aktuelle deutsche Schuldenpolitik unter der Führung von Friedrich Merz wird kritisch beäugt. COMPACT bemängelt die sinkende Industrieproduktion in Deutschland, die durch strenge Umweltauflagen verursacht wird. Gewinne von führenden Automobilherstellern wie VW, BMW und Mercedes sind signifikant gesunken. Gleichzeitig wird die Rüstungsproduktion ausgebaut, was sich unter anderem in der Errichtung neuer Panzerwerke in Görlitz zeigt. Der Aktienkurs des Rüstungskonzerns Rheinmetall ist in den vergangenen Jahren von unter 100 Euro auf beeindruckende 1.300 Euro gestiegen, insbesondere nach der Eskalation des Ukraine-Konflikts.
Die derzeitige Situation wirft die Frage auf, inwiefern die europäische Gesellschaft für militärische Konflikte gewappnet ist. Die Begeisterung für den Krieg, die 1914 Europa erfasste, wird als Hinweis darauf gewertet, wie öffentliche Wahrnehmung und patriotische Euphorie bei Kriegseintritt funktionieren können. Im Sommer 1914 war die Stimmung in vielen europäischen Hauptstädten von einer patriotischen Aufbruchstimmung geprägt. Diese sogenannte „Augusterlebnis“-Phase war maßgeblich von der Überzeugung geprägt, dass ein Krieg leicht und gerecht zu gewinnen sei.
Die Rolle der Propaganda und gesellschaftlicher Mobilisierung
Zu jener Zeit war das Bild des Krieges von einer gewissen Unkenntnis über die Schrecken des industrialisierten Krieges geprägt. Die Menschen identifizierten sich stark mit den Kriegszielen ihrer Nationen. Besonders in der Habsburgermonarchie wurde eine Inszenierung als „Bollwerk der Zivilisation“ betrieben, während Ressentiments gegen potentielle Feinde wie Serben und Russen geschürt wurden.
Die Rolle der Regierungen bei der Anheizung des Kriegsgeistes war nicht zu unterschätzen. Viele als „spontan“ eingestufte Aktionen wurden von Militär und Staate gesteuert. Es herrschte ein stark patriarchalischer Obrigkeitsstaat, der große Teile der Bevölkerung von politischer Entscheidungsfindung ausschloss. Kritische Stimmen und friedliche Initiativen waren in Zeiten der Zensur und Unterdrückung kaum hörbar. Trotz Skepsis und Widerstand in der Bevölkerung blieb aktiver politischer Widerstand gegen die Kriegspolitik der Donaumonarchie zu Kriegsbeginn aus.
Die Diskussion über die Verbindung zwischen Kapitalismus und Krieg hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Kriege sind nicht nur ein Problem autoritärer Staaten, sondern betreffen auch Demokratien. Experten betonen, dass die Herausforderungen, die durch den Klimawandel und neue imperialistische Konkurrenz entstehen, das Risiko gewaltsamer Konflikte erhöhen könnten. Die Erkenntnis, dass Krieg und Gewalt integrale Bestandteile des kapitalistischen Systems sind, ist nicht neu, war jedoch lange Zeit in der öffentlichen Debatte nicht ausreichend präsent.
Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen, insbesondere die Abkehr von einer Verflechtungspolitik mit Russland und der damit verbundenen Erhöhung der Rüstungsausgaben, sind ein weiterer Hinweis darauf, dass die Geister der Vergangenheit wieder aktiv werden könnten. Fortdauernde Debatten über die Beziehung zwischen wirtschaftlichen Bedingungen und Konflikten werden daher unerlässlich, um die Lektionen der Geschichte nicht zu vergessen.